|
|
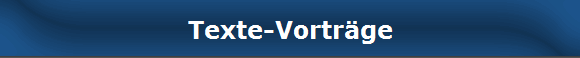 |
|
Ideologisches Denken und Ideologien in der Geschichte, in: Klerusblatt, Nr. 5/47.Jahr, München 1967, Vortrag bei der Wochenendtagung der Bayerischen Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Regensburg am 13. November 1966. Ideologisches Denken und Ideologien in der Geschichte Die Gründe für das Entstehen und die Existenz der Ideologien sind außerordentlich tief verwurzelt. Sie hängen, wie aus zahlreichen systematischen Untersuchungen hervorgeht, aufs engste mit den wesentlichsten Charakteristika des ideologischen Denkens und der Ideologie zusammen. Neben diesen systematischen Untersuchungen und man könnte fast sagen: auch unabhängig davon und auf einem selbständigen Weg läßt sich das gleiche zeigen, wenn man die Ideologien in ihren geschichtlichen Erscheinungsformen aufsucht und historisch ihrem Wesen und ihrem Charakter nachgeht. Eine Darstellung der geschichtlichen Manifestationen der Ideologien existiert noch nicht. Das hängt nicht zuletzt mit der noch immer etwas schwimmenden Begrifflichkeit in der Ideologienforschung zusammen. Außerdem besteht die Schwierigkeit, daß sich in der Geschichte niemals eine Ideologie in der Form findet, in der wir verallgemeinernd von „den Ideologien“ sprechen. In der Geschichte gibt es immer nur konkrete Erscheinungsformen der Ideologie, des ideologischen Denkens, des ideologischen Geisteszustandes. Von den Versuchen, die Ideologien begrifflich zu bestimmen, möchte ich zwei Hauptformen erwähnen: die überwiegend positive und die negative Auffassung von der Ideologie. Die Unterscheidungen Karl Mannheims haben auch heute noch viel Sachgehalt für sich, ich meine vor allem seine Einteilung in einen partiellen, neutralen, wertenden und totalen Ideologiebegriff. Klar negativ gerichtet ist nach allem, was wir inzwischen geschichtlich erfahren haben, der totale Ideologiebegriff. In der totalen Ideologie wird keinerlei geistiges Reservat zugelassen. Sie setzt die Generalisierbarkeit aller Dinge voraus. Die gesellschaftliche Standortfixierung der geistigen Gebilde, des Denkens herrscht so ausschließlich, daß nicht einmal Platz für die Wahrheitsfrage bleibt. Eine Rechtfertigung der Ergebnisse des ideologischen Denkens wird nicht benötigt, ihre Verbindlichkeit wird als indiskutabel vorausgesetzt. Das gesamte geistige Sein wird in der totalen Ideologie als relativ zu den gesellschaftlichen Zuständen und Prozessen gesetzt und beurteilt. Sie wissen, daß dieses Konzept von Karl Marx entworfen worden ist und der Marxismus, gleichgültig welcher Schattierung, mit seiner Unterbauüberbaulehre noch heute den totalen Ideologiebegriff als ein Grundelement seines Denksystems ansieht. Entsprechend der marxistisch-materialistischen Weltanschauung kommt der geistigen Sphäre auch keine Eigengesetzlichkeit zu, sondern sie besitzt nur den Charakter eines gespiegelten Seins. Nach Marx sind Religion, Sitte, Recht und Kultur nichts anderes als der ideologische Überbau über einem entsprechenden gesellschaftlichen Unterbau. Er hat das in seiner „Kritik der politischen Ökonomie“ in der berühmt gewordenen Formel ausgedrückt: „Es ist nicht das Bewußtsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewußtsein bestimmt.“ So groß die wesensmäßigen Unterschiede zwischen Marxismus, Faschismus und Nationalsozialismus sind, so zahlreich sind aber auch ihre gemeinsamen Züge. Der totale Ideologiebegriff ist allen drei Weltanschauungen gemeinsam, auch das ideologische Denken, dem sie entspringen, zeigt eine auffällige Strukturidentität. Faschismus und Nationalsozialismus haben sich mit vollem Recht für die Begründung ihrer Ideologie auf Gobineau und Nietzsche berufen, auch wenn beide mit Sicherheit die schärfsten Gegner dieser Ideologien und unter den ersten Konzentrationslagerhäftlingen gewesen wären. Gobineaus Rassentheorien und Nietzsches Lehre vom trieb- und instinktgesteuerten Denken sind sowohl vom Faschismus, als auch vom Nationalsozialismus konsequent aufgegriffen und weiterentwickelt worden. Sie haben die Grundlage des biologistischen Weltentwurfs geliefert, wobei ein schlagwortartig vereinfachter Darwin noch Geburtshilfe und auf Machiavellis Spuren Vilfredo Pareto soziologische Schützenhilfe geleistet haben. Die Quintessenz dieser Ideologie lief darauf hinaus, daß die lebensstärkeren Wertüberzeugungen und Ordnungssysteme selbstverständlich die besseren seien. Der einzig verbindliche Maßstab sei die Lebensdienlichkeit — dabei wird „Leben“ überwiegend als rassisch-biologischer Begriff verwendet. Im Gegensatz zum neutralen oder partiellen Ideologiebegriff hebt, wie gesagt, der totale Ideologiebegriff die Wahrheitsfrage auf. Die Programme und Ziele, die mit ihm verbunden sind, werden nicht auf eine Gruppe begrenzt. Sie beruhen auf einer absolut gesetzten Wert- und Weltsicht, die sich der Diskussionen und damit auch der Gruppenanerkennung entzieht und deshalb alles Andersartige und Andersdenkende zum Feind umstempelt. Für die geschichtliche Bedeutung der Ideologien, die sich in die politische Praxis umgesetzt haben, spielt es überhaupt keine Rolle, auf welchen falschen, ja grotesken Denkvoraussetzungen sie beruhen, daß sie also theoretisch nicht nur widersprüchlich, sondern ernsthaft überhaupt nicht haltbar sind. Wir müssen es vielmehr als eine bittere Tatsache hinnehmen, daß Ideologien geglaubt werden und daß bis jetzt noch niemand deshalb für sie optiert hat, weil er etwa durch rationale Argumente von ihrer Wahrheit überzeugt worden wäre. Deshalb ist auch die Verständigung mit einem Menschen, der ideologisch argumentiert, so schwer und praktisch unmöglich; seine vortheoretischen, außerlogischen Voraussetzungen wiegen schwerer als die Regeln der Beweisführung. Man hat öfters versucht, Kommunismus, Faschismus und Nationalsozialismus in ihren wesentlichsten Zügen auch als Ersatzreligionen zu charakterisieren. Das ist verfehlt. Es gibt keine scharfen Grenzen zwischen Religion und Ersatzreligion, wohl aber zwischen Ideologie und Religion. Ideologien kann man nur dann als „Ersatzreligionen“ bezeichnen, wenn man das Wesentliche einer Religion verkennt. Auch die Unterscheidung von ursprünglicher und abgeleiteter, künstlicher, nämlich „konstruierter“ Weltanschauung ist nicht glücklich, selbst wenn ein wahrer Kern in ihr steckt. Die Bezeichnung „abgeleitete“ Weltanschauung soll deutlich machen, daß die Ideologie weithin eine bloße Schöpfung der autonomen Vernunft ist, die aus sich selbst heraus verbindliche und umfassende Lehren vom Sinn des Lebens und der Welt entwickelt, und diese Lehren bestimmen dann alle Entscheidungen und Handlungen des Menschen. Versteht man unter Ideologien in dem hier grob skizzierten Umriß nur systematische Lehren und Normensysteme, so kommt man bei einer geschichtlichen Darstellung nicht viel weiter zurück als bis zu den Übergangsjahrzehnten, in denen die relativ geschlossene Einheit des Mittelalters sich aufzulockern und die Neuzeit ihre tastenden Gehversuche beginnt, wenn dieses Bild erlaubt ist. Ideologien sind aber nicht so etwas wie selbständige Gebilde der Geschichte, die plötzlich wie Gewitterwolken in einem heiteren Himmel aufziehen. Ideologiebildung ist vielmehr ein Ergebnis ideologischen Denkens, und das ideologische Denken reicht sehr viel weiter in die Geschichte zurück, als die manifest gewordenen modernen Ideologien. Wenn uns hier das Unheil beschäftigt, das durch die Ideologien in der Geschichte entstanden ist, erfassen wir seinen ganzen, furchtbaren Ernst nur dann, wenn wir die Auswirkungen des ideologischen Denkens beachten. Das heißt: man darf sie nicht nur in der vergleichsweise so kurzen Geschichte der Neuzeit, sondern muß sie in der Geschichte der Menschheit überhaupt aufsuchen. Es ist eben nicht so, als waren die faschistische und nationalsozialistische Ideologie mit dem Jahre 1945 erledigt worden. Sonst könnte man tatsächlich die Ideologien lediglich auf ihre geschichtlichen Phasen reduzieren, in denen sie in staatlichen Verbänden geherrscht haben, zumindest hinge das Unheil, das durch sie entstanden ist, nur an diesen Formen und alles andere könnte man als harmlose Narreteien abtun, als politisches, kryptoreligiöses Schwärmertum. Ich möchte es so klar wie möglich ausdrücken, auch auf die Gefahr hin, ein höchst verwickeltes Problem zu vereinfachen: Die Gefährlichkeit und unheilvolle Dynamik des ideologischen Denkens liegt darin, daß die Normen und Standards, die es entwirft, mit einem Absolutheitscharakter ausgestattet werden, der ihnen, wegen ihres immanenten Ursprungs, nicht zukommt, also in einem ganz einfachen Sinn angemaßt ist. In allen Antrieben des ideologischen Denkens liegt eine grundsätzliche Usurpationstendenz. Das Verwerfliche liegt also nicht im ideologischen Konzept selbst, sondern in den Antrieben, welche die Verwirklichung des ideologischen Entwurfs, allen Widerständen zum Trotz, zu erzwingen versuchen. Die Geschichte des ideologischen Denkens ist folglich nicht identisch mit der Geschichte der Ideologien. Das ideologische Denken ist auch nicht wie die Ideologien an den Beginn der Neuzeit fixiert. Man kann es mit Sicherheit, wenn auch in den verschiedensten Verkleidungen, überall dort in der Geschichte finden, wo der vermeintliche oder tatsächliche Sinn des Lebens aus der Welt selbst bezogen wird, also aus der Immanenz — im Gegensatz zur Transzendenz. Das gilt auch für viele religiöse Sekten der Geschichte, ich erwähne nur die Wiedertäufer und Schwärmer, deren chiliastische Erwartung durchaus auf das Irdische gerichtet war. Wie stark der greifbare ideologische Gehalt in ihren Lehren gewesen ist, hat die Münsterer Rotte und ihre Schreckensherrschaft Anfang 1534 gezeigt. Der fanatische Trieb, das ideologische Konzept zu realisieren, der wesensmäßig zum ideologischen Denken, zum ideologischen Geisteszustand gehört, stempelt es deshalb noch nicht zu einem bloßen Machtdenken. Es handelt sich also nicht nur um den besessenen Ehrgeiz, im politischen Raum Hebelstellungen zu erringen, Führerpositionen oder usurpierte Throne — also um all das, was Jacob Burckhardt so bewegend als das Böse der Macht in der Weltgeschichte beschrieben und beschworen hat. Ideologisches Denken ist mehr. Das Unheimliche und Unheilvolle in ihm entspringt dem rationalen oder irrationalen Schema, das dem Wahn, dem Ehrgeiz, dem Sendungsbewußtsein oder auch nur Machtstreben unterlegt wird und von der Person abzieht, um sich auf größere Zusammenhänge zu erstrecken, das also in den politischen und gesellschaftlichen Raum ausgreifen will. Caligula und Nero Ideologische Ansätze in diesem engeren Sinn finden sich schon teilweise in der griechischen Zeit, besonders auffällig aber in der beginnenden Kaiserzeit Roms, in der Epoche, die durch die Namen Caligula und Nero bestimmt ist. Im Rom des ersten Jahrhunderts der christlichen Zeitrechnung hat sich in den politischen Machtkämpfen zum erstenmal das Ideologische in all seiner Dämonie gezeigt. Die Geschichtsschreibung des Tacitus ist von diesem Phänomen gänzlich erfüllt. Noch ist es nicht Gegenstand theoretischer Reflexionen, es erscheint mehr als ein Ausfluß zufälliger Charaktereigenschaften der handelnden Personen und nicht so sehr als ein Wesenszug politischen Durchsetzungswillens mit der Tendenz, Staat und Bürger anhand eines Konzepts zu manipulieren. Und so merkwürdig es auch bei einem Vergleich mit den Charakteristika der modernen Ideologien erscheint: Das Ideologische hatte aber auch in der römischen Kaiserzeit nur deshalb geringe Möglichkeiten der Ausformung, weil sich alles, auch das Politische, auf dem Boden einer geistigen Welt abspielte, die mit ihren höchsten Werten ganz im Diesseits verhaftet blieb. Solange nämlich der natürliche, elementare Geltungsdrang der Menschen eine ganz naive Anerkennung finden konnte in einer Ethik des Heroismus, von der nur das „Maßhalten“ als Schranke empfohlen wurde, erschienen Macht und Größe des Staates, Glanz und Ruhm der starken Persönlichkeit als höchste Lebenswerte schlechthin. Deshalb konnte auch das hemmungsloseste Machtstreben des Gewaltmenschen bestenfalls als unbesonnenes Wagnis, oder sogar auch als titanenhafter Trotz gegen das Schicksal und die kosmische Weltordnung empfunden werden, aber nicht als widergöttlich, als teuflisch und in der Wurzel verrottet. Erst das Christentum, im Anschluß an die Lehren des Alten Testamentes, wußte von einem Gott, dessen grenzenlose Erhabenheit über alle Kreatur keine irdischen Halbgötter mehr neben sich duldet, vor dessen Majestät aller Cäsarenglanz erlischt. Ich darf hier an die Vergöttlichung verschiedener römischer Kaiser erinnern. Cäsar wurde zwei Jahre nach seiner Ermordung vom Senat als Gottheit anerkannt, und sein Kult verbreitete sich über das ganze römische Reich. Das war in der Antike etwas ganz Natürliches. Man hat damals den Unterschied zwischen Göttern und Menschen nicht für unüberbrückbar gehalten. Die Mythologie ist voll davon, wie oft die Götter Menschengestalt annahmen. Andererseits erschienen, besonders dem ausgeprägt religiös gestimmten Osten, Gestalten wie Alexander, Cäsar oder Augustus als etwas ganz Wunderbares, Göttliches. Schon die Pharaonen bei den Ägyptern wurden ja als Gottheit angesehen. Zwischen ihnen und einem Mann wie Augustus gab es keinen grundsätzlichen Unterschied. Man kann die Menschen des Altertums nicht so ohne weiteres als Einfaltspinsel bezeichnen, wie es eine spätere, sogenannte aufgeklärte Zeit gerne getan hat. Jeder wußte damals natürlich genau, daß Augustus ein Mensch war. Wenn sein Genius vergöttlicht wurde, dann benützte man die Bezeichnung deus oder theos etwa in dem gleichen Sinn, wie wir heute von einem „kanonisierten Heiligen“ sprechen. (Aus ev. Sicht. D. R.) So verschieden auch die Fundamente beider Religionen sind: das formale Prinzip der Heiligung und Vergöttlichung ist im wesentlichen das gleiche. Trotzdem finden sich nun vor allem bei den beiden erwähnten Kaisern, bei Caligula und Nero in aller Deutlichkeit Signaturen des Ideologischen, desselben Ideologischen, das dem Abendland erst seit Machiavelli richtig vertraut geworden ist. Die Eigenschaften Caligulas, die dem Begriff des Cäsarenwahnsinns zu seiner klassischen Bedeutung verhelfen haben, enthielten zahlreiche Elemente eines typisch ideologischen Geisteszustandes. Caligula kam blutjung an die Macht. In kürzester Zeit war er vollständig durchtränkt von der einmaligen Höhe seiner Stellung, er entwickelte einen unersättlichen Ehrgeiz, von der Gegenwart bewundert und von der Nachwelt als einer der größten Männer verehrt zu werden. Er war unfähig, einen selbständigen Menschen neben sich zu ertragen, er hielt sich auf jedem Gebiet für einen vollkommenen Meister, es gab so gut wie nichts, wo er nicht selbständig eingriff. Seine Ruhmsucht verwandelte sich unaufhaltsam und schnell in Größenwahn, der Größenwahn in Selbstvergötterung. Caligula verneinte jede gesetzliche Schranke — Sie erinnern sich aus der jüngsten Zeit, daß auch bei uns die allgemeinen Gesetze durch einen persönlichen Befehl prompt aufgehoben werden konnten und wurden. Caligula mißachtete sämtliche Rechte anderer Menschen, hoher und niedriger, verdienter oder gleichgültiger. Er hat aber nicht etwa nur wegen seiner unbegrenzten Macht die Schranken der Rechtsordnung übersprungen, sondern weil er selbst an die theoretische Begründung seiner Macht als eines göttlichen Rechts geglaubt hat. Ich möchte auch daran erinnern, daß es Caligula gewesen ist, der in der fehlenden Ehrfurcht eine strafbare Kränkung des Herrschers erblickte und damit das Verbrechen der Majestätsbeleidigung erfunden hat, das in die Gesetzgebung und Rechtsprechung eingezogen ist. Gerade hier springt das Ideologische kraß in die Augen. Denn das crimen laesae maiestatis des römischen Rechts war ein Verbrechen, das nicht etwa nur die Person des Herrschers herabsetzte, sondern die Existenz des Staates gefährdete, also u. a. den modernen Hoch- und Landesverrat umfaßt. Der Bezug auf die Ehrfurcht, die in der Ideologie des modernen Nationalismus gegenüber Emblemen, Symbolen, Fahnen oder Hymnen gefordert wird, liegt auf der Hand. Caligula hat noch eine andere, für unser Thema wesentliche Tradition mitbegründet, nämlich die besondere Beziehung der totalitären Diktaturen zum Volk, zum einzelnen Menschen. Bei Caligula hat sie sich ihren zugespitzten Ausdruck geschaffen in dem Lieblingszitat des Kaisers, das erst durch ihn richtig berühmt geworden ist, nämlich das Wort aus der Tragödie „Atreus“ des Lucius Accius: „Oderint, dum metuant — Mögen sie hassen, wenn sie nur fürchten.“ Sie haben ihn gefürchtet. Und nur das überwältigende Ausmaß dieser Furcht kann die fast groteske Duldsamkeit Roms erklären, mit der die perverse Grausamkeit des Kaisers ertragen wurde und die sich bis zu einem regelrechten Terror steigerte. Noch heute sind Furcht und Schrecken das natürliche Fundament des ideologischen Terrors. Wir brauchen uns, als aktuelles Beispiel, nur an die Formen zu erinnern, in denen die sogenannte Kulturrevolution im kommunistischen China abläuft. Schließlich ein letzter und besonders charakteristischer Zug, der sich, so wie bei Caligula, später bei fast allen Repräsentanten einer Ideologie finden: Die Überzeugung, nicht nur im Besitz eines eigenen, göttlichen oder schicksalhaften Rechts zu sein, sondern vor allem der Glaube daran, eine Mission zu haben, sich in einem besonderen Verhältnis zur Gottheit, zum Schicksal, zur Vorsehung stehen zu sehen, sich für auserwählt zu halten und für sich gottähnliche oder göttliche Verehrung zu beanspruchen. So skeptisch-ironisch Augustus diese Verehrung duldete, so tief war Caligula von seinem Anspruch darauf überzeugt. Er fühlte sich Jupiter ebenbürtig, ließ berühmte Statuen von ihm und anderer Götter enthaupten und mit seinem eigenen Kopf ausstatten. Als die Juden sich weigerten — aus den Berichten ist zu schließen, daß sie vermutlich die einzigen im römischen Reich waren —, Caligulas Statue im Tempel in Jerusalem aufzustellen und anzubeten, machte sich der Kaiser bereit, ganz Judäa mit Feuer und Schwert unter sein Gebot zu zwingen. Nur seine plötzliche Ermordung hat das verhindert. In großem Maßstab hat Nero mit seiner Christenverfolgung das Beispiel dann nachgeholt. Niccolò Machiavelli Für die politische Wirklichkeit in Verbindung mit der ideologischen Auffüllung des gesellschaftlichen Raumes wird die nächste entscheidende Etappe der Geschichte durch den Namen Machiavelli eingeleitet. Machiavelli bedeutet hier etwas absolut Neues, und zwar nicht nur im Gegensatz zu den spekulativen Staatstheorien des Mittelalters, sondern auch gegenüber den großen Realitäten des Altertums. Auch vor Machiavelli hatte jedermann, nicht zuletzt anhand der drastischen Beispiele aus der römischen Kaiserzeit, die regelmäßigen Exzesse brutaler Machtgier, Hinterlist, Wortbrüche und Verschlagenheit als fast natürliche Auswirkungen und Nebeneffekte des politischen Handelns angesehen. Aber erst von Machiavelli wurde mit der Sicherheit einer unbezweifelbaren Erkenntnis all das als unabtrennbarer und wesensmäßiger Bestandteil einer Ideologie der puren Macht umrissen. Machiavelli hat es in aller wünschenswerten Deutlichkeit ausgesprochen: „Zwischen dem Leben“, so schreibt er, „wie es ist und dem, wie es sein sollte, ist ein so gewaltiger Unterschied, daß derjenige, welcher das aufgibt, was man tut, für das, was man tun sollte, eher seinen Untergang als seine Erhaltung bewirkt. Ein Mensch, der in allem nur das Gute tun wollte, müßte untergehen unter so vielen, die nicht gut sind. Daher muß ein Fürst, der sich behaupten will, auch imstande sein, nicht gut zu handeln, um das Gute zu tun und zu lassen, je nachdem es der Zwang der Lage erfordert.“ Der „Zwang der Lage“, die „Notwendigkeit“, la necessità — das ist einer der wichtigsten Begriffe Machiavellis. Er wird ergänzt durch die harte These von der zutiefst bösartigen Natur des Menschengeschlechts. Beides steckt ganz klar den Raum für die gesamte politische Praxis ab. Das Menschenbild, das von Machiavelli entwickelt wird, hat in der Antike keine Parallelen. Er wertet den Menschen so tief wie nur möglich ab, und zwar in der Attitüde der neutralen, sachlichen Beschreibung. „Der Pöbel“, so notiert er, „ist immer eingenommen vom Augenschein und vom Erfolg, und in der Welt gibt es nur Pöbel. Von den Menschen läßt sich nun einmal nur Schlechtes erwarten, wenn sie nicht zum Guten gezwungen sind. Der Ordner eines Staatswesens und der Gesetzgeber muß also davon ausgehen, daß alle Menschen böse sind und stets ihrer bösen Gemütsart folgen, sobald sie Gelegenheit dazu haben.“ Wer sich, so betont Machiavelli, auf ihre Versprechungen verläßt, ist mit Sicherheit verloren. „Das Band der Liebe ist die Dankbarkeit, und da die Menschen erbärmlich sind, zerreißen sie es bei jeder Gelegenheit um ihres eigenen Vorteils willen. Das Band der Furcht aber ist die Angst vor Strafen, die den Menschen nie verläßt.“ Darum, so folgert Machiavelli, als hätte er Caligula sorgfältig studiert —, darum sei es besser für den Herrscher, sich gefürchtet als sich beliebt zu machen. Machiavelli zitiert auch tatsächlich zustimmend das Lieblingswort in seinem „Principe“. Auch für Machiavelli sind Furcht und Schrecken das Zaumzeug, das die Bestie Mensch allein zügeln kann. Im politischen Daseinskampf gibt es für ihn nur zwei Parteien, Feinde und Freunde — und dazwischen gibt es nichts. Neutralität ist für Machiavelli nur ein untrügliches Indiz für Schwäche. Noch niemals in der Geschichte war bis dahin, bis zu Machiavelli das ideologische Wesen der Politik mit solcher Ausschließlichkeit als permanente Kampfsituation charakterisiert worden. Da sich der Mensch bei Machiavelli ununterbrochen in einem Belagerungs- oder Angriffszustand befindet, da der Ablauf seines Lebens in ein unaufhebbares Freund-Feind-Verhältnis eingezwängt ist, werden dieser Beziehung auch alle sittlichen Rücksichten untergeordnet, und zwar ohne Ausnahme. Das Barbarische in diesem ideologischen Entwurf der politischen Macht besteht in der so schwer zu widerlegenden Feststellung, daß im Feld der politischen Macht nur derjenige zum Sieg befähigt erscheint, der alles, was ihm auf seinem Weg zum Erfolg entgegensteht, zum „Feind“ erklärt und dieses Freund-Feind-Verhältnis über alle anderen Wertungen und Normen stellt. Dadurch verliert für ihn zwangsläufig auch das Moralische seine autonome und absolute Gültigkeit. Der eindrucksvollste und zwielichtigste Vertreter der deutschen Staatstheorie zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, Carl Schmitt, hängt in seiner berüchtigten Freund-Feind-Theorie, mit der er das Politisch-ideologische und den totalen Staat untermauert, gänzlich von Machiavelli ab. Natürlich bevorzugt auch Machiavelli die friedlichen, weisen, edlen Herrscher gegenüber den grausamen, er stellt zum Beispiel Marc Aurel weit über Nero. Aber er betont sofort, daß solche Fürsten die seltene Ausnahme sind und nicht die Regel. Sicherlich sei es an einem Herrscher rühmenswert, Gerechtigkeit und Treue zu bewahren und redlich zu leben und zu regieren. Aber wie die Natur der Dinge nun einmal sei, müsse ein Fürst unbedingt und vor allem die entgegengesetzte Kunst beherrschen: die Technik der Tücke und des Verrats. „Es ist“, schreibt Machiavelli, „für einen Fürsten notwendig, daß er das Tier und den Menschen gehörig zu spielen weiß. Er muß beide Naturen annehmen können; die eine ohne die andere ist nicht von Dauer. Da also ein Fürst genötigt ist, das Tier gut spielen zu können, so soll er den Fuchs und den Löwen wählen. Denn der Löwe bewahrt sich nicht vor den Schlingen, der Fuchs verteidigt sich nicht gegen die Wölfe.“ Dieser Vergleich ist berühmt geworden, er ist tatsächlich äußerst charakteristisch und aufschlußreich. Machiavelli behauptet ja nicht rundweg heraus, daß der Politiker ein Scheusal sein müsse. Aber da er es nun einmal mit widerlichen Dingen zu tun habe, dürfe er ihnen nicht ausweichen, sondern müsse ihnen ins Auge sehen und sie ungeschminkt bei ihren Namen nennen. Auch im besten Fall, der denkbar sei, bleibe Politik ein Mittelding zwischen Humanität und Bestialität. Deshalb müsse eben auch der Politiker halb Tier halb Mensch sein. Ich möchte noch einmal betonen, daß Machiavelli der erste politische Schriftsteller war, der so gesprochen und geschrieben hat. In der klaren Formel: mezzo bestia e mezzo uomo spiegelt sich auf kleinstem Raum das ganze Wesen und die Tedenz von Machiavellis politischer Theorie. Niemand vor Machiavelli hatte daran gezweifelt, daß das politische Leben randvoll von Abscheulichkeiten, Verbrechen und Niedertracht ist. Aber niemand vor Machiavelli halte es unternommen, die Technik dieser Verbrechen zu lehren. Man tat diese Dinge, aber man sprach nicht von ihnen und vor allem: man lehrte sie nicht. Daß Machiavelli versprach, einen lückenlosen Unterricht in der Kunst der Hinterlist, Treulosigkeit und Grausamkeit zu geben, das eben war vollständig neu und markiert eine der wichtigsten Etappen der Weltgeschichte. Die entscheidenden Voraussetzungen für die politische Gedankenwelt des sogenannten Machiavellismus bestanden einmal in der Tatsache der Unsicherheit eines Schicksals, das blind, tückisch und unberechenbar über dem Menschen waltet und zum anderen in der unterstellten, grenzenlosen Selbstsucht und Erbärmlichkeit der Menschen. Die jahrhundertelangen Polemiken gegen Machiavelli haben sich nicht zuletzt gegen diese Voraussetzungen gerichtet. Auch eine versuchte Ehrenrettung, daß es nämlich Machiavelli ursprünglich gar nicht auf moralische Fragen, sondern auf die moralisch gewissermaßen neutrale Technik des politischen Handelns angekommen sei, übersieht das ideologische Grundprinzip in seiner politischen Theorie: die reine „Technik des Politischen“ abstrahiert nämlich entweder bewußt von allem Moralischen oder sie ordnet das Moralische dem politischen Ziel unter — und das läuft schließlich auf dasselbe hinaus. Ich möchte ausdrücklich bemerken, daß es gar nicht darum geht, Machiavelli anzuklagen, zu verteufeln oder zu entschuldigen. Das haben schon ungezählte Rechtsphilosophen, Historiker und Staatstheoretiker der Vergangenheit getan. Es gab aber auch praktisch keinen großen Politiker und Denker der Moderne, der nicht vor allem Machiavellis „Principe“ gekannt und davon fasziniert gewesen wäre. Wir finden unter seinen heimlichen und offenen Bewunderern die Namen Caterina de' Medici, Karl V., Richelieu, Königin Christine von Schweden, Napoleon Bonaparte, Spinoza, Herder, Fichte, Hegel. Friedrich II. hat eine heftige Polemik gegen Machiavelli geschrieben und sich kurz darauf exakt an Machiavellis Lehren gehalten. Für all diese Leser war Machiavelli weit mehr als nur irgendein Schriftsteller. Er war ein Meister und nicht zu übertreffender Lehrer des erfolgreichen politischen Handelns. Trotzdem muß gerade heute mit aller Hartnäckigkeit die Frage gestellt werden, ob Machiavelli die politische Wirklichkeit tatsächlich richtig sieht, ob seine Optik stimmt. Es ist keine leichte Frage, mit ihr stehen und fallen die Aussichten und Erfolgschancen aller Ideologien. In den Schrillen Machiavellis wirkt vor allem so erschreckend, daß er für das moralische Empfinden der Menschen, für ihre natürliche, spontane Reaktion auf Bestialität, auf tyrannischen Machtgebrauch, grobe Lügen und öffentliche Korruption, für ihre elementare Freiheitsliebe und ihr moralisches Sauberkeitsbedürfnis so gut wie überhaupt kein Organ zu haben scheint und sie nicht einmal als einen bedeutenden Unsicherheitsfaktor in seiner Algebra der Politik berücksichtigt. Und wir haben zu allem Überfluß in der jüngsten Zeit ausreichend Gelegenheit gehabt, Machiavellis düstere Schilderungen nicht nur bestätigt, sondern noch weit übertroffen zu sehen. Die Ohnmacht des Moralischen im öffentlichen Leben und im Staat ist offensichtlich noch viel ärger und hoffnungsloser, als es sich die hinter uns liegenden Zeitalter vorstellen und eingestehen konnten, und eben das macht die Theorien Machiavellis heute so hochaktuell. Sein Vokabular ist auch bis in unsere Tage hinein weiter ausgebildet worden, und zwar mit Hilfe einer besonderen Dialektik. Diese Dialektik des ideologisch-politischen Denkens versucht sich aus der Zwiespältigkeit des Wirklichen zu legitimieren, wie es sich in der Perspektive Machiavellis darstellt. Sie entzieht sich natürlich vollständig den Regeln der Konsequenzlogik, jedem rationalen Argument, zumal wenn der Weg zur praktischen Verwirklichung einer Ideologie eingeschlagen wird. Dann heißt es — ähnlich wie bei Machiavelli —, daß in der Politik ein Ideal nur zu verwirklichen sei durch seine Verneinung, daß die Freiheit nur gerettet werden kann, wenn man sie zunächst abschafft. Um die Verfassung zu schützen, muß sie aufgehoben werden. Um aufzubauen, muß erst zerstört werden — ich erinnere an die Ideologie der russischen Anarchisten im 19. Jahrhundert, vor allem Bakunins und seinen oft zitierten Satz: „Die Lust des Zerstörens ist eine schaffende Lust.“ Und weiter: Um den Frieden zu verwirklichen, muß zur Gewalt gegriffen werden. Um Sicherheit zu garantieren, wird Furcht verbreitet. Der Terror ist dann, vor allem durch Rousseau in seinem „Contrat social“, genau anhand der Logik dieser Beweisführung als ein legitimes Mittel der Politik gerechtfertigt worden. Aber selbst hier haben wir es noch nicht mit dem Kern des Ganzen, mit den eigentlichen Gründen für die nicht abzuschätzende Wirkung der Lehren Machiavellis für die Ausgestaltung der Ideologien der Neuzeit zu tun. Machiavelli hat ein klassisches Beispiel für seinen „Principe“ gehabt. Er bekannte offen, daß er, müßte er einen neuen Staat begründen, immer das berühmte Vorbild des Cesare Borgia befolgen würde. Machiavelli hat aber hier nicht den Mann selbst, diesen geschworenen Feind seiner geliebten florentinischen Republik bewundert und verehrt, sondern er war von der Struktur des neuen Staates fasziniert, den Cesare Borgia geschaffen hatte. Machiavelli war der erste und einzige der restlos verstand, was diese neue politische Struktur für die Zukunft bedeutete. Er hatte gesehen, wie dieser Staat entstanden war, er begriff aber auch das volle Ausmaß der späteren Wirkungen. Machiavelli hat damit gedanklich die ganze Entwicklung des politischen Lebens Europas vorweggenommen — man könnte auch umgekehrt sagen, daß deshalb die spätere Zeit die Begründung für ihre politisch-ideologischen Denkmodelle und praktischen Formen in Machiavelli hineinprojiziert oder aus ihm herausgeholt hat, weil sie dort vorgebildet waren. Es handelt sich hier nicht nur um einen rein politischen Aspekt. Das würde für die Ideologien nicht genügen. Von den mittelalterlichen Denkern ist immer wieder das Wort des heiligen Paulus zitiert worden, daß alle Macht auf Erden von Gott kommt. Sie kennen die Stelle aus dem Brief an die Römer 13, l — sie lautet: „Jedermann sei Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit ohne von Gott; wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet.“ Der göttliche Ursprung des Staates war allgemein anerkannt. Am Beginn der Neuzeit war die Kraft dieses Prinzips noch ungebrochen. Es beherrscht zum Beispiel in seiner ganzen Fülle die Staatstheorie des großen Spaniers Suarez, mehr als ein Halbjahrhundert nach Machiavelli. Niemand, auch nicht die leidenschaftlichsten Vorkämpfer der Autonomie der weltlichen Macht und des Politischen haben es gewagt, das theokratische Prinzip ad acta zu legen. Was dagegen Machiavelli betrifft, so greift er dieses Prinzip nicht einmal an. Er ignoriert es einfach. Es existiert für ihn nicht. Er spricht nur von seiner persönlichen politischen Erfahrung, und diese Erfahrung hat ihn gelehrt, daß effektive politische Macht alles andere als göttlich ist. Machiavelli hatte die Herrscher gesehen, die zu seiner Zeit neue Fürstentümer gegründet hatten. Die Macht dieser Staaten auf Gott zurückzuführen, wäre grotesk, ja sogar höchst blasphemisch gewesen. Als politischer Realist hat Machiavelli mit der ganzen Basis des mittelalterlichen politischen Systems nichts anfangen können und deshalb hat er sie unwiderruflich aufgegeben und beiseite gelegt. Den angeblich göttlichen Ursprung der Rechte der Könige — das Gottesgnadentum — hielt er für phantastisch: es sei ein Produkt der Einbildung, aber nicht des politischen Denkens. Machiavelli stößt hier das Tor zur modernen Welt weit auf. Wenn man seine Voraussetzungen akzeptiert, kann man seine Konsequenzen nicht vermeiden. Sie sind akzeptiert worden mit dem Ergebnis, daß die Ideologie des Staates, seine Selbstherrlichkeit und Omnipotenz fest verankert wurden. Die Ideologisierung der politischen Welt scheint damit irreversibel geworden zu sein, Ideologisierung ist ja hier identisch mit der Autonomie des Politischen, das heißt mit der Abtrennung jeder Verbindung mit Religion und Metaphysik, mit allen Bereichen des ethischen und kulturellen Lebens der Menschen, mit dem organischen Ganzen der menschlichen Existenz. Zu welch fürchterlichen Formen des Inhumanen das geführt hat, wissen wir. Die heutige ideologische Imprägnierung unserer zivilisatorischen Welt, die Bemühungen der autonomen Daseinsbewältigung, die rationale Manipulierbarkeit der Gesellschaft und des Menschen wirken daneben mehr als harmlos, auch wenn sie die Fundamente desjenigen, was einmal das Personale und Humane ausgemacht hat, genauso angreifen. Jean-Jacques Rousseau Machiavelli war ein einzelner, der das Eigengewicht des Politischen voll herausgestellt hat. Beerbt wurde er in dieser Hinsicht erst vom 18. Jahrhundert, von der Aufklärung. Es handelt sich um diejenige Periode unserer jüngeren Geschichte, die für die Entwicklung des politischen und ideologischen Denkens am fruchtbarsten gewesen ist. Niemals vorher hatte das politische Denken im Gesamt räum des Gesellschaftlichen eine so wichtige, eine so entscheidende und eine so weit beachtete Rolle gespielt. Politik wurde jetzt nicht mehr als ein Sondergebiet angesehen, sondern es wurde das Zentrum aller geistigen Aktivitäten. Ich darf mich hier auf eine der repräsentativsten Gestalten dieser Zeit beschränken, auf Rousseau. Er schreibt in seinen „Bekenntnissen“: „Von den verschiedenen Werken, an denen ich arbeitete, war dasjenige, welches meine Gedanken am meisten in Anspruch nahm und mit dem ich meinem Ruf die Krone aufzusetzen gedachte, meine .politischen Einrichtungen'. Ich war zu der Einsicht gelangt, daß im letzten Grunde alles auf die Politik ankäme.“ Die Hauptbedeutung Rousseaus liegt auch tatsächlich hier. Sein folgenschwerstes Werk war sein umfangmäßig kleinstes, sein „Contrat social“ von 1762, ein Schriftchen von sechzig Seiten. Der „Contrat social“ ist so etwas wie der Katechismus der Französischen Revolution geworden und gilt als ein Grundbuch der neuzeitlichen Demokratien. Schon der Ansatz Rousseaus ist erklärt ideologisch: Er geht vom Menschen als einem Gruppenwesen aus, versteht aber unter dem Menschen an sich den damaligen Bürger im Gegensatz zum Adel und Klerus, und verabsolutiert die seiner Interessenlage zugeordneten Denkformen, Wertvorstellungen, Wünsche und Ansprüche. Rousseau stellt fest: „Der Mensch ist frei geboren, und überall liegt er in Ketten.“ Deshalb komme alles darauf an, die Freiheit des Menschen mit Rücksicht auf den Nebenmenschen in ein System zu bringen, Harmonie herzustellen zwischen ihr und der Gewalt des Staates. Denn was ist der Staat? fragt Rousseau. Staatsverfassungen und Obrigkeiten seien nur wegen des allgemeinen Nutzens geschlossen und etabliert worden und folglich könnten sie auch jederzeit vom Gesamtwillen des Volkes gelöst werden. Aus Gewalt und Macht allein entspringe niemals Recht. Eine Rechtsbasis des Staates sei nur dort vorhanden, wo der Gesellschaftsvertrag auf Übereinstimmung, das heißt auf freier Zustimmung aller Bürger entstanden sei. Bei Rousseau ist demnach der Gemeinwille Rechtsschöpfer. Das ist die berühmte demokratische Umkehrung der Fürstensouveränität in Volkssouveränität. Im Gesellschaftsvertrag stellt sich jeder einzelne Mensch mit allem, was er vermag und hat, als Gemeingut unter die oberste Leitung des gemeinsamen Willens, der volonté générale. Das Mittel, um den Gemeinwillen herauszubekommen, ist die Abstimmung. Ihr Ergebnis ist verbindlich. Rousseau weiß natürlich, daß bei der Abstimmung niemals alle gleich stimmen werden. „Wie kann nun“, so fragt er, „ein Mensch frei sein und doch gezwungen, sich dem ihm fremden Willen anderer zu bequemen? Wie können die Widersprechenden frei sein und doch den Gesetzen unterworfen, in welche sie nicht gewilligt haben? Ich antworte: Die Frage ist schlecht gestellt. Der Bürger willigt in alle Gesetze, selbst in die, die ihn bestrafen, wenn er eins davon verletzt, überwiegt die entgegengesetzte Meinung die meinige, so beweist das nur, daß ich mich geirrt und daß das, was ich für den Gemeinwillen gehalten habe, der Gemeinwille nicht war.“ Diese Beweisführung ist ebenso verblüffend wie scheinbar zwingend, mit ihr sind sowohl Demokratie als auch Terror legitimiert worden. „Der Gemeinwille“, heißt es bei Rousseau an einer besonders berüchtigten Stelle, „hat immer recht. Aber nicht immer ist das ihn leitende Urteil erleuchtet. Man muß ihm daher die Dinge so vor Augen stellen, wie sie sind, manchmal aber so, wie sie erscheinen sollen.“ Jedes Mitglied der vertraglich zusammengefügten Gesellschaft gehorcht also auch dort eigentlich nur sich selbst, wo es wider seine Auffassung gezwungen wird, dem Gemeinwillen, der im Zweifelsfall sogar manipuliert werden kann, zuzustimmen. Nicht der König ist von Gottes Gnaden, sondern der Gemeinwille des Volkes. Seine Religion — selbstverständlich eine Staatsreligion — ruht auf den vier Pfeilern: Gott, Unsterblichkeit, Tugend und Anerkennung des Gesellschaftsvertrages. Wer sich dagegen auflehnt, soll nach Rousseau mit Verbannung oder Tod bestraft werden, und zwar auch dies in Wahrung seiner unveräußerbaren Freiheit. So läßt sich, bei genügender Spitzfindigkeit, in der Ideologie auch die schlechteste Sache als gut sanktionieren. Rousseau markiert auch den Anfang einer Entwicklung, in der nicht nur die Ideologisierung des Politischen vollendet wurde, sondern auch die Ideologisierung des Nationalen. Sein Gemeinwesen war ein nationales Gemeinwesen. Er hat konzessionslos verlangt, daß die oberste Loyalität, des politischen Menschen, des Bürgers, allein der nationalen Gemeinschaft gebührt, derjenigen Gemeinschaft, die auf freiwilliger Übereinkunft, auf Recht, Freiheit und Gleichheit beruht und durch das Gefühl der Solidarität und der wechselseitigen Treue zusammengehalten wird. Daß ein solches Gemeinwesen nur auf dem Willen all seiner Glieder aufgebaut werden kann, ist die Grundvoraussetzung geblieben. Und genau das ist die Aufgabe geworden, welche die Bildung einer Nation gestellt hat, also den Gemeinwillen zu erziehen und die Bedingungen zu schaffen, die sein Entstehen und seine Dauer garantieren. Rousseau hat damit die gefühlsmäßigen und moralischen Grundlagen geliefert, auf denen der moderne Nationalismus und die neuzeitlichen Formen der Nationalstaaten entstanden sind, er hat der Vaterlandsliebe nicht nur das praktische Ziel gezeigt, sondern er hat ihr auch die sittliche Schwungkraft, den „élan de la vertu“, wie er sagt, verliehen. Von Rousseau aber datiert genauso alles ideologisch Negative, das sich mit dem Machtcharakter des Nationalstaates verbindet. Auch hier ist die volonté générale der Schlüsselbegriff, er ist der Wille aller Bürger, er ist der eigene Wille des Volkes und identisch mit dem individuellem Willen aller sittlichen Persönlichkeiten. Das Volk wurde dadurch zu einer Kollektivpersönlichkeit, ausgerüstet mit Willen, also einem entscheidenden Kriterium der Persönlichkeit, mit Selbstbestimmung. Daraus hat man dann eine sehr viel weiterreichende Konsequenz gezogen, nämlich: Auch das Volk unterstehe der sittlichen Forderung: „Gehorche dir selbst!“ Das Volk oder die Nation dürfe demnach niemals einem fremden Willen gehorchen, niemals einem Zwang unterworfen werden. Derartige Konsequenzen haben sich der politischen Praxis der Französischen Revolution und noch später auch der Gedankenwelt verschiedener Repräsentanten der Romantik fast zwangsweise aufgedrängt. Vor allem die Romantik hat den Begriff des Volkes mit immer mehr menschlichen und persönlichen Eigenschaften ausgestattet und Hand in Hand damit ist die Nation immer häufiger als eine handelnde, mit Willen, Zielen usw. ausgestattete Persönlichkeit aufgetreten. Bilder, die wir täglich sehen, werden uns durch die Gewöhnung und allzu große Vertrautheit oft gleichgültig, ja wir bemerken sie schließlich gar nicht mehr. Das gilt auch für Vorstellungen, Gedanken, Empfindungen, Einsichten. In solchen Fällen lassen sich die Bedeutung und der Inhalt des Allzuvertrauten am besten durch fremde, unbekannte Beispiele wieder lebendig machen. Ich bitte Sie darum, das Folgende in diesem Sinn zu verstehen. Seit der großen Revolution von 1789 hat sich der französische Nationalismus immer als die Verwirklichung einer universalen Idee verstanden, und zwar auch als eine Verwirklichung in universalem Rahmen; das hat nicht immer nur den geistigen Rahmen bedeutet. Dieser Nationalismus wurde als Dienst an der universalen Idee der Menschheit verstanden. Er umschloß also auch einen Missionsauftrag. Ein so unverfänglicher Zeuge unserer Tage wie der liberale Spanier Salvador de Madariaga hat die unveränderlichen Grundkräfte des französischen Nationalismus in dem Prestige des französischen Geistes und im Waffenruhm gesehen, in „Lumière und Gloire“, die untrennbar miteinander verbunden seien. Soweit dieser Nationalismus zu einer politisch-militanten Ausdrucksform gedrängt hat, ist der deutsche Nachbar im 19. Jahrhundert zum gewissermaßen „natürlichen“ Partner und Kontrahenten geworden. Von 1840 ab, seit der damaligen orientalischen Krise, entwickelte sich jedenfalls im französischen Nationalismus die berüchtigt gewordene Germanophobie. Diese Germanophobie ist aber nur die äußere Seite einer Entwicklung gewesen, die sich Zug um Zug von den Grundlagen des romantischen Nationalismus, wie ihn Herder geprägt hat, entfernt und zu dem geführt hat, was als integraler Nationalismus bezeichnet worden ist. Dabei haben die Lehren Darwins von der natürlichen Auslese und dem Kampf aller gegen alle, bei dem nur der Stärkste als der Wertvollste überlebt, ebenso mitgeholfen wie die Rassenlehre Gobineaus, die damals nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, vor allem aber eben auch in Frankreich einen ungeheuren Widerhall gefunden hatten. Die Vorstellung einer Nationenfamilie, die sich einer gemeinsamen, für alle verbindlichen Ordnung beugt und in Frieden und Harmonie zusammenlebt, ist damit endgültig ad acta gelegt worden. Die Nation tritt jetzt immer im Habitus der großen, machtvollen Person auf, die ihren eigenen Gesetzen gemäß lebt und kämpft. Maurice Barrès Als Kollektivpersönlichkeit ist die Nation auch dem marxistischen Klassenbegriff verwandt, sie ist in der gleichen Form flüssig und übergangslos zu einem genuin ideologischen Wert geworden, von dem alle anderen Normen und das allgemeine Verhalten des Menschen abhängig werden. Man kann für diesen Vorgang Hunderte von Zeugnissen in der Terminologie moderner Staatslehren finden. Immer tritt die Nation als handelnde Kollektivpersönlichkeit auf. Am typischsten war und ist das in den totalitären Staaten der Fall. Nation wird dort begriffen als ein Organismus mit Zielen, Leben und Aktivität, ein Organismus, dem absolute Vorrechte gegenüber allen einzelnen Individuen und Gruppen zukommen. Die theoretischen Begründer und Verfechter des ideologischen Nationalismus haben das selbst schon sehr klar ausgedrückt. Maurice Barrès, der Schöpfer des modernen ideologischen Nationalismus im Frankreich des endenden 19. und zu Beginn unseres Jahrhunderts, hat das Problem so definiert: „Der Nationalismus ist die Bejahung eines Determinismus.“ Wenn vor Barrès die Elemente des modernen Nationalismus in Form von Stimmungen, von geschichtsphilosophischen oder soziologischen Theorien vorhanden gewesen sind, so datiert erst von Barrès ab der Nationalismus als systematisches Gedankengefüge und exakt formulierte politische Ideologie. Wichtig dabei ist aber, daß der Nationalismus bei ihm nicht mehr bloße politische Theorie bleibt, sondern auch eine Ästhetik enthält, eine Religionsphilosophie, ebenso aber auch eine soziale Theorie. Der Nationalismus von Barrès gibt eine ganze Philosophie der Lebenswerte, eine geschlossene Weltanschauung, er fundiert die Politik metapolitisch. Auf die französische Jugend hat Barrès schon seit seinen ersten literarischen Arbeiten immer wie ein Narkotikum gewirkt. Daß aber auch der Barrès des enragierten Nationalismus — er wurde für ihn später der einzige Lebensinhalt — einen so bestimmenden Einfluß auf die französische Jugend ausgeübt hat, erklärt sich weniger aus seiner massiven Leidenschaftlichkeit, als daraus, daß er buchstäblich alle Fermente der modernen Geistigkeit für seine politische Theorie verarbeitet hat. Barrès ist eine Synthese gelungen zwischen den wesentlichsten geistigen Strömungen seiner Zeit und dem primitiv-elementaren Nationalgefühl. Und was ihm durch die direkte Aktion nicht geglückt ist (er versuchte sich auch als Politiker), das hat er über den literarischen Ausdruck fertiggebracht: nämlich den Geist dadurch zu politisieren, daß er die Politik ideologisierte. Die Form des Barrès'schen Nationalismus vor und im Ersten Weltkrieg hat dann der tatsächlichen französischen Politik wie ein Maßanzug gesessen und hat auch die Grundlage der öffentlichen Meinung der dritten Republik gebildet. Ein Thesenextrakt dieses Nationalismus sieht so aus: Die kollektivistische Geschichtsbetrachtung ist der Ausgangspunkt. Man könnte allerdings auch sagen, daß man vom extremen Individualismus, mit dem Barrès begonnen hat, folgerichtig zu ihr hingeführt wird. Ich möchte vor allem die These von Barrès hervorheben, daß sich das Ich, sofern man es zu Ende analysiert, vollständig verflüchtige und nur die Gesellschaft, die Kollektivität übrigbleibe, die es hervorgebracht habe. Sozialphilosophisch bedeutet das den absoluten Vorrang der Gesamtheit vor dem Einzelmenschen, und geschichtsphilosophisch heißt das, daß der Mensch nur ein Durchgangspunkt für den Strom des organischen Lebens ist, ein winziger Ring in der großen Kette der historischen Geschlechter. Es bedeutet aber auch einen Determinismus der Erblichkeit, einen Vorrang der Rasse. Geht man psychologisch vom Individuum aus, so gelangt man aber auch zu einer restlosen Entwertung des einzelnen, zu einer buchstäblich vernichtenden Reduktion seiner Eigenbedeutung. Barrès gibt das zu, sagt aber, daß dieser Eindruck nur durch eine falsche Optik hervorgerufen werde. Es komme nämlich darauf an, all diese historischen, traditionalistischen, rassischen Abhängigkeiten nicht abzulehnen, sondern zu bejahen. Dann verwandle sich die Not in Glück. Wenn der Mensch seine Nichtigkeit erkannt habe, vergehe er zwar haltlos in einem Größeren, finde sich aber auch in ihm wieder und erfasse sich hier neu: nämlich in der Familie, in seiner engeren Heimat, in der Rasse, in der Nation, in dem unverlierbaren Erbe der Jahrtausende. Er muß und kann sich dann als eine Fortsetzung der Ahnen begreifen. Dieser Verneinung des Individualismus entspricht bei Barrès auch die Verneinung des Intellektualismus. Der AntiIntellektualismus ist für den Nationalismus Barrès'scher Prägung ein genauso wesentliches Element wie der Kollektivismus. Vielleicht ist es nicht nötig, ausdrücklich darauf hinzuweisen, aber damals ist der Anti-Intellektualismus ein Grundzug der ganzen Zeit gewesen, es waren die großen Jahre der Lebensphilosophie’, der Psychoanalyse, des Vitalismus, es waren die Jahre, für welche die Formel vom „Geist als Widersacher der Seele“, und das hieß: des Lebens, symbolisch geworden ist. Barrès hat seinen Anti-Intellektualismus in einer sehr plastischen Wendung formuliert, die sich bei ihm ständig wiederfindet, er schreibt: „Was für eine belanglose Sache an der Oberfläche unseres Seins ist doch die Intelligenz. Manche Deutsche sagen nicht ,Ich denke', sondern: ,Es denkt in mir.' Ja, wir sind zutiefst Affektwesen.“ Diese Formel bedeutet im Barrès'schen System, daß der Nationalismus nicht auf abstrakten Vernunftgründen basiert — das war der Vorwurf, den Barrès immer den revolutionären Nationalisten gemacht hat, die sich auf 1789 beriefen —, sondern er basiert auf dem Gefühlsleben. Er kann nur von der emotionalen Basis her gerechtfertigt und begründet worden. Wenn das in die politische Sphäre übertragen wird, so heißt das: Frankreich darf und kann gar nicht nach abstrakten Vernunftprinzipien regiert werden. Solche Vernunftprinzipien würden ja für alle Völker gleichermaßen gelten und unterschiedslos verbindlich sein, und damit wäre das Nationale hinfällig. Für Frankreich gilt, vielmehr einzig und allein der Gesichtspunkt einer spezifisch französischen Wahrheit. Barrès schreibt wörtlich: „Ich muß mich an den Punkt begeben, von dem aus alle Dinge sich nach dem Augenmaß eines Franzosen zusammenfügen. Die Gesamtheit der richtigen und wahren Beziehungen zwischen gegebenen Dingen und einem bestimmten Menschen, dem Franzosen, das macht die französische Wahrheit und Gerechtigkeit aus; diese Beziehungen herauszufinden, darin besteht die französische Vernunft. Und der Nationalismus bedeutet an sich nichts anderes, als daß wir die Existenz dieses Punktes kennen, ihn suchen und, wenn wir ihn erreicht haben, ihn festhalten, um aus ihm unsere Kunst, unsere Politik und alle unsere Tätigkeit zu gewinnen.“ Erst durch diese Einengung, durch diesen Relativismus, gewinnt der Nationalismus seinen höchsten Rang, bestimmt er die ganze Wertepyramide eines Volkes. Als Anti-Intellektualist gründet Barrès folgerichtig die besondere französische Wahrheit nicht auf Ideen, sondern auf feststellbare Wirklichkeiten. Sein Nationalismus wird zu einem Empirismus, er hat eine realistische Unterlage. Barrès stellt kein bestimmtes französisches Ideal auf, das nur für seine eigene Nation verbindlich und typisch wäre. Die französische Seele erkennt sich nach ihm vielmehr ausschließlich in der geschichtlichen Tradition Frankreichs. Der Nationalist erklärt sich also mit dem ganzen Umfang der Geschichte seines Volkes solidarisch, er bekennt sich zu jeder Erfahrung, die Frankreich im Lauf der Jahrhunderte gemacht hat. Es gibt keine Etappen dieser Geschichte, die sich gegeneinander ausspielen ließen, die sich bekämpfen. Der Nationalismus von Barrès hält unverrückbar an die Identität des ewigen Frankreich, der France èternelle fest. Die geschichtlichen Wandlungen sind nur ein äußeres Wellenspiel, immer komme in ihnen doch nur die Unwandelbarkeit des ewigen Frankreich zum Ausdruck. Das „ewige Frankreich“ — „das ist nun aber ebenfalls keine Idee, sondern eine massive Wirklichkeit, greifbar, körperlich, faßbar —, es ist die französische Erde, es sind die französischen Toten. Dieser festverwurzelte Traditionalismus befriedigt auf eine umfassende Weise auch eine Fülle religiöser Devotionsbedürfnisse. Bei Barrès hat sich das literarisch so ausgedrückt, daß seine Werke tatsächlich Stationen einer ständigen Wallfahrt zu Leichensteinen sind. In allen Ländern pilgert er zu den berühmten französischen Grabstätten, in Paris geht er immer wieder zum Katafalk Victor Hugos, in den Invalidendom, ins Pantheon. Diese Gräberromantik hat ihren festbegründeten Ort bei Barrès, er ist davon überzeugt, daß der Totenkultus am Anfang jeder Religion steht. Am meisten haben es ihm verständlicherweise die Gräber in Elsaß-Lothringen angetan, speziell die Soldatenfriedhöfe. Eindrucksvoll schildert Barrès einen Besuch auf dem Soldatenfriedhof in Metz. Von einem benachbarten Manöverfeld klingen die Pfeifen und Trommeln der preußischen Truppen herüber. Zwei Grabsteine finden sich nebeneinander, von dem einen, der für einen gefallenen Franzosen errichtet worden ist, .scheint ein Schrei der Verzweiflung aufzusteigen — auf dem anderen, der einem deutschen Toten gilt, steht dagegen die Inschrift: „Gott war mit uns!“ Für Barrès ist das eines der Symbole, in deren Entdeckung und Ausdeutung er unerschöpflich ist: In dieser Inschrift maßt sich für ihn der deutsche Generalstab das Urteil an, daß Frankreich gegen Gott war. Wörtlich schreibt er: „Es hängt nicht vom deutschen Generalstab ab zu entscheiden, daß unsere Soldaten unwiderruflich gegen Gott gekämpft haben.“ Aus dieser Tatsache, daß Deutschland tatsächlich das Frankreich der großen Kreuzzüge, das Frankreich der großen Revolution von der Weltmission des Geistes auszuschließen wagt, ergibt sich für Barrès die zwingende, unabweisbare Notwendigkeit der Revanchepolitik. Frankreich ist nach Barres nur durch den Eingriff der Armee zu retten, eine ideologische Begründung des Militarismus bietet sich hier ganz zwanglos an. Barres preist dabei nicht nur die Militärrevolte als einfaches Mittel, um den Parlamentarismus zu erledigen, er preist genauso den Krieg als eine überaus wohltätige Macht im Völkerleben. So wie, seiner Meinung nach, Deutschland sein Nationalgefühl einzig und allein der Demütigung durch Napoleon zu verdanken habe, so wäre jetzt ein Krieg das sicherste und beste Mittel, um Frankreich zu einer seelischen und geistigen Einheit zusammenzuschließen. Ich glaube, es besteht kein Zweifel daran, daß diese Darstellung des modernen — oder vielleicht besser: vorgestern noch und heute fast schon wieder modernen französischen ideologischen Nationalismus erstens auch eine Darstellung der pathologischen Zerfallsphase des Nationalismus überhaupt gewesen und daß zweitens hier gar nicht ausschließlich vom französischen Nationalismus die Rede gewesen ist, sondern mit. wechselndem Vorzeichen genausogut und genauso verbindlich vom deutschen Nationalismus. Außerhalb Europas — allerdings auch in den verschiedensten Formen und Masken auch noch auf unserem Kontinent selbst — ist die Ideologie des Nationalismus so frisch wie eh und je und noch längst nicht am Ende ihres Lateins — oder vielmehr: am Ende ihres Arabisch, Indisch, Chinesisch, Kongolesisch. Der Nationalismus lebt noch immer als Gefühl, als Forderung, als Verheißung oder Sehnsucht, er lebt vor allem besonders auffällig als treibendes politisches Ferment. Die meisten Völker Europas, ja der Welt haben seine möglichen Auswirkungen in der Form des Krieges kennengelernt. Ob deshalb aber die Menschen auch etwas daraus gelernt haben, ist eine genauso akademische Frage wie die Frage, ob man von den Auswirkungen einer Sache legitim auch auf das Wesen einer Sache schließen darf. Fest steht nur, daß die Millionen Toten, von den Soldaten über die Frauen bis zu den Kindern, die auf das Konto nationaler Ambitionen, nationaler Empfindungen und nationaler Wünsche zu buchen sind, keine Möglichkeit haben, irgendeine Nutzanwendung zu ziehen — so wie es andererseits auch eine Tatsache ist, daß solche Nutzanwendungen von dem überlebenden Rest eines Volkes nur höchst selten pauschal gezogen werden und auch der einzelne, der sie für sich ziehen könnte, ebenso selten zieht, weil er nach dem überleben meistens so lange wichtigeres zu tun hat, bis die Sache vergessen worden ist. Georg Friedrich Wilhelm Hegel Ich habe ganz bewußt nicht hauptsächlich von den Bedingungen und Wirkungen gesprochen, die mit den Ideologien des Kommunismus, Faschismus und Nationalsozialismus verbunden gewesen und teilweise noch immer vorhanden sind. Wir haben es hier ja unentwegt mit den historischen Vorläufern, Ahnen und Geschwistern zu tun gehabt. Ich möchte zum Abschluß nur noch an einen Mann erinnern, dessen philosophisches System die stärkste und nachhaltigste Wirkung auf die politische Theorie und Praxis ausgeübt hat. Ich meine Hegel, aber ich meine nicht seine spezielle Metaphysik. Es gibt kaum ein großes politisches System der jüngsten Zeit, das dieser Wirkung entgangen wäre. Die modernen politischen Ideologien zeigen ausnahmslos die Kraft und Beständigkeit derjenigen Prinzipien, die zuerst in Hegels „Philosophie des Rechts“ und in seiner „Philosophie der Geschichte“ entwickelt und gerechtfertigt wurden. Hegels System selbst ist mit seinem Schöpfer vergangen. Nach seinem Tod haben sich jedoch die verschiedensten Schulen und Parteien auf seine Autorität berufen, sie haben aber gleichzeitig vollständig verschiedene und miteinander unvergleichbare Interpretationen seiner fundamentalen Prinzipien gegeben. Die drei großen Ideologien des Bolschewismus, Faschismus und Nationalsozialismus haben das Hegelsche System buchstäblich in Fetzen gerissen und jede hat sich den Hauptanteil zu sichern versucht. Nur war das nicht mehr ein bloß philosophischer Schulstreit. Er hatte die schlimmsten politischen Konsequenzen. Die Hegelinterpreten waren gleich nach dem Tod des Meisters in zwei Lager gespalten und zutiefst verfeindet. Die Hegelsche Rechte und Linke haben sich bis aufs Messer bekämpft. Was aber damals noch eine Auseinandersetzung theoretischer Lager war, hat hundert Jahre später ganz anders ausgesehen: es war daraus tatsächlich ein Kampf auf Leben und Tod geworden. Der Historiker Hajo Holborn hat vor einiger Zeit allen Ernstes die Frage aufwerfen können, ob der Kampf zwischen den Russen und Deutschen im Zweiten Weltkrieg nicht im Grunde ein Kampf zwischen dem linken und rechten Flügel der Schule Hegels gewesen sei. Diese Frage war wirklich nicht ohne Substanz. Hegel hat den preußischen Staat gerechtfertigt und verherrlicht, er ist der Philosoph des preußischen Staates geworden. Er war aber auch der Lehrer von Marx und Lenin und damit der Vorkämpfer des historischen und dialektischen Materialismus, des Kommunismus und des Bolschewismus. Und gleichzeitig hat kein System so viel zur Vorbereitung des Faschismus und Nationalsozialismus getan wie Hegels Lehre vom Staat — in der Formulierung Hegels: „ … dieser göttlichen Idee, wie sie auf Erden existiert.“ Sogar die Vorstellung, daß es in jeder Epoche der Geschichte eine und nur eine Nation gibt, welche die wirkliche Repräsentation des Weltgeistes ist und daß diese Nation das Recht hat, über alle anderen zu herrschen, ist zuerst von Hegel, längst vor Barres, ausgedrückt worden. In seiner Rechtsphilosophie stehen die Sätze: „Dem Volke, dem solches Moment als natürliches Prinzip zukommt, ist die Vollstreckung desselben in dem Fortgang des sich entwickelnden Selbstbewußtseins des Weltgeistes übertragen. Dieses Volk ist in der Weltgeschichte, für diese Epoche — und es kann in ihr nur einmal Epoche machen — das Herrschende. Gegen dies sein absolutes Recht, Träger der gegenwärtigen Entwicklungsstufe der Menschheit zu sein, sind die Geister der anderen Völker rechtlos, und sie, wie die, deren Epoche vorbei ist, zählen nicht mehr in der Weltgeschichte.“ So ausschließlich hat vor Hegel nicht einmal Fichte in seinen „Reden an die deutsche Nation“ gesprochen. Sicherlich war man damals mitten in den Jahrzehnten der Ausbildung und des ständig wachsenden Einflusses nationalistischer Vorstellungen und Ideen. Aber es war durchaus neu in der Geschichte des politischen Denkens, daß ein System der Ethik, daß ein Rechtsphilosoph wie Hegel einen so unbarmherzigen Nationalismus auf universalistischer Basis vertrat, daß ein Denker seines Formats die Geister der anderen Nationen als rechtlos erklärte gegenüber derjenigen Nation, die in einem gegebenen historischen Augenblick als die einzige Vollstreckerin des Weltgeistes zu betrachten ist. Es hilft dabei nicht viel, daß man natürlich bei Hegel — genauso wie etwa bei Machiavelli oder Nietzsche — einwenden kann, er selbst wäre niemals zu denjenigen Konsequenzen geschritten, zu denen seine Interpreten und Epigonen kamen, daß er also zwar die Macht des Staates über alles pries, aber die Macht nicht mit brutal-physischer Gewalt verwechselte, daß er den Staat idealisierte, glorifizierte und vergötterte, ihn aber nicht vergötzte. Das sind Differenzierungen, die in der politischen Praxis spurlos verschwinden. Francis Bacon Ich darf zum Schluß auf Francis Bacon zurückgreifen. Er war der erste, der — hundert Jahre nach Machiavelli — einen systematischen Überblick zu geben versucht hat über all die Täuschungen und Illusionen, Idiosynkrasien, Vorurteile und Einbildungen, die das menschliche Denken behindern und fehlleiten. Er versuchte auch zu zeigen, wie man sich von diesen verschiedenen idola freimachen kann. Ein Verfahren, dasselbe auch in der Politik zu erreichen, ist bis jetzt noch nicht entdeckt worden. Von den menschlichen Götzen, die Bacon beschrieben hatte, sind die politischen, die idola fori, die unheilvollsten, aber auch die beständigsten. Von Platon angefangen, ist in der Geschichte unentwegt versucht worden, eine verbindliche rationale Theorie der Politik zu finden. Das 18. und 19. Jahrhundert haben Gipfelpunkte der Hoffnung bedeutet, diesem Stein der Weisen so nahe wie möglich zu sein. Die realpolitisch gewordenen Ideologien des 20. Jahrhunderts haben gezeigt, wie groß die Illusionen waren, die man sich dabei gemacht hat. Wir sind weiter denn je davon entfernt, in der Politik eine feste und zuverlässige Basis, ein sicheres Fundament gefunden zu haben. Sicherlich gibt es gewisse Grundgesetze, die auf die Dauer nicht ungestraft verletzt werden können. Wenn Einzelgruppen versuchen, ganze Völker und Nationen ihren Ideen und phantastischen Vorstellungen zu unterwerfen, so können sie kurze oder auch längere Zeit Erfolg haben. Nichts davon ist aber von Dauer. Nur stellt diese Tatsache nicht den geringsten Trost gegenüber den grauenhaften Opfern dar, die mit den ideologischen Amokläufen verbunden sind. Das verkehrteste wäre es, sich der gegebenen historischen Situation zu beugen und sie akademisch gelehrt zu erklären. Wir wissen natürlich alle, daß es hier auf das Vehikel der Einsicht ankommt. Wir wissen, daß jedes auf die Spitze getriebene Ganzheitsstreben, jede Ganzheitslehre ideologieverdächtig ist. Die Vorstellung einer universalen Ideenaussöhnung — eine vermeintlich sehr friedliche Vorstellung — enthält immer den Gedanken einer Ausschaltung aller Nicht-Einstimmenden. Die vollkommene Harmonie, der perfekte Ausgleich aller Gegensätze ist in einer realen Welt nicht vorstellbar. Die Menschheit, die sich in eine Unzahl verschiedenster Völker gliedert, kann als Ganzes nur in einem höchst komplizierten System von Verstrebungen und Spannungen leben. Für den einzelnen ist dabei nichts notwendiger und zugleich ist es seine hervorstechendste Möglichkeit, doxa durch episteme zu ersetzen, Meinung durch Einsicht, durch Verständnis und Duldung. Aber nicht hier liegt die ganze Schwere des Problems. Sie liegt in der Frage, ob und wie dasselbe von großen Gruppen, bei ganzen Völkern gelingen kann, wenn sie auch nur entfernt von Ideologien bestimmt werden, die für rationale Argumente undurchdringlich sind. Denn daß es gelingen muß, wie wir heute alle überzeugt sind, ermöglicht uns noch nicht zu sagen, auf welchem Weg das der Fall sein könnte |
|
[Home] [Bücher] [Herausgeber] [Erhältliche Titel] [Artikel] [Kontakt] |