|
|
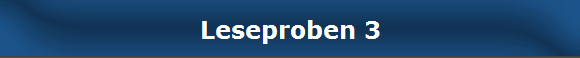 |
|
|
|
Deutschland Einig Vaterland Ein Querkopf braucht kein Alibi
Ein Heidegger im Olympiakader, Inbegriff der Renaissance, aber auch Inspiration für das heutige Lebensgefühl: Leon Battista Alberti, Kapitel „Logik der Leistung“ aus dem Buch „Geschichte macht Mut“, sowie erschienen in: Die Welt, Geistige Welt, 11.03.1989.
Deutschland Einig Vaterland „Noch immer fehlt der Chronist, der das Elend der ersten Jahre nach 1945 schildert. Er müßte als Schüler Homer verschlungen, als junger Mann lange genug den Kopf verloren, als Erwachsener von Thukydides gelernt und als Mann seine Gedanken an Laotse überprüft haben. Ein solcher Chronist würde sein Empfinden nicht an die Bitterkeit verraten. Das Material für ein Epos der geschlagenen Deutschen liegt als gewaltiger Steinbruch von Dokumenten, Berichten und wahrhaft stigmatisierenden Schilderungen von Abertausenden Zeitzeugen bereit. Viel von der Atmosphäre enthält der Film »Der dritte Mann«. Aus der Vorgeschichte findet sich mehr als genug in dem Roman »Der Fragebogen« von Ernst von Salomon, - ein hohnlächelnd schrilles, verzweifeltes, unverwüstlich vitales Werk. Das besetzte Land und sein Volk waren ein riesenhaftes Gemenge, amorph, durcheinander brodelnd, brutal in Besatzungszonen gezwängt, in die sich ununterbrochen der Strom Millionen vertriebener Deutscher ergoß. Drei Jahre lang herrschte die Militärverwaltung und der Hunger. Jeder Tag begann mit der gleichen Frage: Wovon leben wir heute? 1946 pendelten die Lebensmittel-Zuteilungen um eintausend Kalorien. In den Großstädten betrug 1947 der Durchschnitt 800 bis 900, im Ruhrgebiet oft nur 600 bis 700 Kalorien. Als unterstes Maß für einen arbeitenden Menschen galten nach internationaler Übereinstimmung dreitausend Kalorien. Für Ludwig Erhard war das »die Zeit, in welcher man errechnete, daß auf jeden Deutschen nur alle fünf Jahre ein Teller komme, alle zwölf Jahre ein paar Schuhe, alle fünfzig Jahre ein Anzug, daß nur jeder fünfte Säugling in eigenen Windeln liegen könne und nur jeder dritte Deutsche die Chance hätte, in seinem eigenen Sarg beerdigt zu werden«. Die Alliierten hatten die schlechten Erfahrungen nicht vergessen, die sie nach dem Ersten Weltkrieg mit den deutschen Kriegsentschädigungen machen mußten. Sie entschlossen sich deshalb, ihre Forderungen nicht durch Geldzahlungen, sondern durch Demontage von Fabrikanlagen, industrielle Erzeugnisse und Lieferungen von Kohle und Stahl zu decken. Dieses Verfahren diente zugleich ihrem Ziel, das deutsche Wirtschaftsniveau radikal zu senken. In der amtlichen Erklärung vom 11. Dezember 1945 über die deutsche Friedenswirtschaft wurde eigens hervorgehoben, »daß der Angreiferstaat Deutschland keinesfalls früher als die Länder, die er durch seinen Angriff verwüstet hat, einen den Vorkriegsverhältnissen entsprechenden Lebensstandard erreichen« dürfe. Den Deutschen bleibe es aber gestattet, die Straßen und das Eisenbahnnetz im Laufe der nächsten fünf Jahre wiederherzustellen und die Wohnungsnot innerhalb von zwanzig Jahren zu beheben. Der Alliierte Kontrollrat legte am 26. März 1946 den ersten »Industrieplan für Deutschland« vor. Bis hin zu namentlich genannten kleinen Firmen, selbst bis zu Fahrrädern wurden die deutschen Industrieunternehmen zahlenmäßig erfaßt und die Produktionsgrenzen festgelegt. Total demontieren und ins Ausland bringen wollte man die »Ausrüstung für die Erzeugung von synthetischem Benzin und synthetischen Ölen, synthetischem Gummi, synthetischem Ammoniak, Kugel-, Rollen-, Kegellager, schweren Werkzeugmaschinen, schweren Traktoren, Metallen, Chemikalien und Funksendeeinrichtungen«. Die Grundstoffindustrie wurde schärfsten Beschränkungen unterworfen, den verbliebenen Industriezweigen Kapazitätszahlen diktiert, die meist nur Bruchteile von der Produktion des Jahres 1938 betrugen. Insgesamt sollte der deutsche Industriestandard um mehr als die Hälfte des Standes von 1938 abgesenkt werden. Die Verwüstungen durch den Luftkrieg wurden genausowenig berücksichtigt wie die Millionen der Vertriebenen. Sichere Schätzungen über die Gesamthöhe der Reparationsleistungen sind nicht möglich. In der Sowjetzone wurden zahlreiche Demontagen, mit denen die Besatzungsmacht sofort begonnen hatte, in den späteren Listen nicht aufgeführt, da sie als »Kriegsbeute« galten. Nach Abschluß des Ausräumungsprozesses war von der Sowjetzone die Gesamtleistung der Reparationen herausgeholt worden, die ursprünglich für ganz Deutschland gelten sollte. Die Sowjetunion dürfte zwischen sechzig und fünfundsechzig Milliarden Mark Reparationen an sich gebracht haben. Die Leistungen der Westzonen lagen etwas niedriger; nicht enthalten in diesen Zahlen ist das beschlagnahmte deutsche Auslandsvermögen von rund sechzehn Milliarden Mark und die Patente und Gebrauchsmuster von fünfzehn bis achtzehn Milliarden. Mehr als psychologische Besänftigung statt als wirkliche Linderung der schreienden Not wirkte sich die Arbeit einer privaten Organisation für Hilfssendungen aus, die 1946 in Amerika gegründet wurde. Sie arbeitete ohne Gewinn. Gegen eine Gebühr von zehn Dollar wurden Kleider und Lebensmittel in die notleidenden Länder Europas geschickt. Auch Westdeutschland nahm bis 1960 an den Segnungen der Care – Pakete teil. Die Amerikaner demonstrierten vom ersten Tag der Besatzung an ihr charakteristisches Bündel widersprüchlicher Haltungen: Arroganz und Liebenswürdigkeit, Herablassung und Bewunderung, Selbstgefälligkeit und Mitleid, Brutalität und Hilfsbereitschaft, Berechnung und Planlosigkeit - ein endloser Katalog des geradlinig verschlungenen Way of life. Appell an den gesunden Sinn Aus der stumpfen, dahinvegetierenden Masse des deutschen Volkes ragten seltsam dickköpfige Männer heraus. Sie arbeiteten zwar nicht anders als ihre Kollegen gehorsam unter den Befehlen der Militärregierungen, sie betrachteten sich aber nicht als bloße Werkzeuge, sondern hatten eigene Vorstellungen. Eines derjenigen Beispiele, die man nicht vergessen sollte, lieferte Johannes Semler, der deutsche Direktor der »Verwaltung für Wirtschaft des Vereinigten Wirtschaftsgebietes« in Frankfurt am Main. Das Amt bildete die ökonomische Kopfstelle der drei westlichen Zonen. Semler, den die widersinnigen Direktiven der Besatzungspolitik mehr und mehr verbitterten, hielt Anfang 1948 ein Referat, das schon nicht mehr kritisch, sondern aufsässig war: »Man hat den Mais geschickt und das Hühnerfutter, und wir zahlen es teuer, in Dollars und deutschen Exporten, und wir sollen uns auch noch bedanken.« Am »bedanken« waren nach dieser Rede die Amerikaner. Sie setzten Johannes Semler wegen der »Hühnerfutter-Rede«, f die prompt die Runde machte, auf die Straße und übertrugen | am 2. März 1948 Ludwig Erhard das Amt. Mit Erhard hatte die Militärregierung in Bayern schon gemischte Erfahrungen gemacht. Die Alliierten und ebenso die von ihnen eingesetzten deutschen Verwaltungsbehörden waren überzeugt, daß in der damaligen Lage Deutschlands - nicht anders als wie im Krieg nur eine unerbitterliche Zwangswirtschaft mit exakt berechneten Zuteilungen der vorhandenen Güter vor dem Chaos bewahren konnte. Wegen dieser Auflagen leitete Ludwig Erhard, der von den Amerikanern im Oktober 1945 zum Staatsminister für Handel und Gewerbe in der bayerischen Regierung unter Ministerpräsident Wilhelm Hoegner ernannt worden war, sein Ressort mehr als widerwillig. Er fühlte sich fehl am Platz. Seine Begründung war denkbar einfach: Wer den Mangel bewirtschaftet, verewigt die Misere. Die Wirtschaft in Form einer Gefängnisorganisation zu leiten, war nicht Erhards Sache. Er trat im Dezember 1946 zurück und beschäftigte sich mit der Ausarbeitung der Pläne für die Wirtschafts- und Währungsreform, die unausweichlich kommen mußte. Die erste Maßnahme hatte für Erhard den Rang eines Axioms: Die Währungsreform mußte mit einer totalen Wirtschaftsreform gekoppelt werden. Was damals, unter unvergleichlich schwierigeren Verhältnissen, einem so klar denkenden und weitblickenden Fachmann wie Erhard zu selbstverständlich war, als daß er ein Jota davon abgestrichen hätte, wird heute, unter unvergleichlich besseren Bedingungen zwischen DDR und BRD aus fadenscheinigen politischen Rücksichten zerredet, zerdehnt, mit halbdurchsichtigen Vorwänden verschleiert, in einer geradezu dilettantischen Form verwässert und zeitlich hinausgeschoben. Für Investitionen etwa steht Kapital in schwindelnder Höhe zur Verfügung. Kein Wunder, daß man sich jetzt in Mitteldeutschland erinnert und der neuen Regierung die Frage stellt, ob sie nicht »einen Ostberliner Ludwig Erhard« finden könne. Die Währungsreform wurde 1948 in den drei Westzonen und in Westberlin durchgeführt. Am Samstag, dem 19. Juni, verlas der Sprecher der Westalliierten über die deutschen Rundfunksender den Text der Gesetze zur Umstellung der deutschen Währung, zur »Neuordnung des Geldwesens«. Das erste trat am 20. Juni in Kraft. Die Abwertung der Reichsmark zur Deutschen Mark erfolgte im Verhältnis 10:1. Davon ausgenommen waren laufenden Verbindlichkeiten wie Löhne, Gehälter, Renten oder Pensionen; für sie galt der Satz l: 1. Am 21. Juni, dem Stichtag der Währungsreform, hielt Erhard eine Rundfunkansprache, der man das Sensationelle heute kaum noch anmerkt: »Ich appelliere nicht an einen dumpfen, nebelhaften Glauben, nicht an das Wunder der Unvernunft, wenn ich unser Volk in seinem Vertrauen zu unserer neuen Währung bestärken möchte, sondern ich appelliere gerade umgekehrt an den gesunden Sinn, die Einsicht und die Erkenntniskraft von Ihnen allen, wenn ich Ihnen vor Augen führe, daß eine Gefahr für die Stabilität des neuen Geldes nicht bestehen kann, wenn wir uns nur einer geordneten öffentlichen Haushaltsführung befleißigen und durch eine ebenso geordnete Geld- und Kreditpolitik dafür Sorge tragen, daß die Übereinstimmung von Güterprodukten und Kaufkraftbildung gewahrt bleibt. - An Wunder vermag ich im Bericht der Wirtschaft nicht zu glauben, und deshalb erachte ich es geradezu als ein soziales Gebot, im Grundsätzlichen mit der Auflösung von Preisbindungen aller Art dem Wettbewerb und der daraus resultierenden Preissenkung Raum zu geben. « Dem Frankfurter Wirtschaftsrat hatte Erhard schon Wochen vorher deutlich gemacht, daß er das Übel an der Wurzel ausrotten wolle, und das hieß: alle Vorschriften für Preise und die Bewirtschaftung aufzuheben, die Zwangswirtschaft abzuschaffen. Erhard entwickelte am 21. April vor dem Wirtschaftsrat die Grundzüge seiner sozialen Marktwirtschaft. Er handelte sich damit die schärfste Opposition der Sozialdemokraten ein, die beschwörend davor warnten, Erhard zu folgen. Kurz vor der Währungsreform wurde Erhard, nach einer Marathonsitzung von zwanzig Stunden, vom Wirtschaftsrat dazu ermächtigt, die Zwangswirtschaft zu beseitigen. Allerdings lag die wirkliche Zuständigkeit nach wie vor bei den Westalliierten, de facto bei den führenden Amerikanern. Ludwig Erhard kümmerte sich um keine Kompetenzen. Er beseitigte am Stichtag der Währungsreform alle bestehenden Preisvorschriften und Anordnungen für die Bewirtschaftung, er machte Schluß mit der Zwangswirtschaft. Die Amerikaner glaubten ihren Augen und Ohren nicht zu trauen. Ein solches Maß an Unverfrorenheit hatten sie nicht erwartet nach Jahren der Demütigung und des Siegergebarens, dessen Wirkung sich Tag für Tag bestätigte, wenn Deutsche unter dem Gelächter der GI's nach Zigarettenkippen griffen. General Lucius D. Clay, Befehlshaber der US-Streitkräfte in Europa und Militärgouverneur für Westeuropa, wies Erhard in rüder, drohender Form zurecht. Erhard habe in alliierte Rechte eingegriffen. Ohne Erlaubnis der Militärregierung dürfe keine einzige Vorschrift über die Bewirtschaftung geändert werden. Ludwig Erhard blickte ihn kalt an: »Ich habe die Vorschriften nicht geändert. Ich habe sie aufgehoben. « Das Geld des Marshallplans Als die Amerikaner entdeckten, wie nützlich deutsche Soldaten waren, bogen sie in die Haarnadelkurve ein, die von der Besatzungsmacht zur »Freundschaft« mit den Westdeutschen führte. Nunmehr erklärte auch General Clay, daß Erhards Beschluß richtig gewesen sei. Mit der Währungsreform begann zwar die Fixierung der politischen Zerteilung Deutschlands, für Westdeutschland aber bedeutete sie auch den Anbruch einer völlig neuen Epoche deutscher Wirtschaftspolitik. Erhards ökonomisches Konzept wurde für viele Staaten der Welt zum Vorbild einer modernen Wirtschaft. In der Literatur zur Nachkriegsgeschichte wird Erhards Genialität häufig eingeschränkt: Seine Maßnahmen hätten letzten Endes keinen Erfolg gehabt, es wäre kein »Wirtschaftswunder« entstanden, wenn die Amerikaner den Deutschen nicht mit dem Marshallplan zu Hilfe gekommen wären. Der Erfolg gebühre also nicht nur Erhard und dem eisernen Fleiß und Aufbauwillen der Deutschen, sondern ebenso ihren rettenden Freunden, den Amerikanern. Der damalige US-Außenminister George C. Marshall hatte in einer Rede in Harvard angeregt, Europa mit einem großzügigen Hilfsprogramm unter die Arme zu greifen. Das »European Recovery Program« (ERP) sollte es den Ländern - auch Deutschland - durch großzügige Sachlieferungen und Kredite ermöglichen, mit eigenen Kräften die Folgen des Krieges zu überwinden. Der ERP-Plan wurde als Auslandshilfegesetz am 3. April 1948 verabschiedet. Im September 1948 flössen die ersten 500 Millionen Dollar in die drei westlichen Besatzungszonen. Der Betrag erhöhte sich bis Ende 1951 auf insgesamt 1,5 Milliarden Dollar - eine gewaltige Summe in der damaligen Zeit. Der Marshallplan stellte in den ersten vier Jahren in Sachleistungen und Krediten rund 17 Milliarden Dollar für die europäischen Länder bereit. Doch der Mythos vom Freund, der dem armen Geschlagenen auf die Beine hilft, findet keine Bestätigung in der Wirklichkeit. So wie nach dem Ersten Weltkrieg, so weckte auch 1945 das Ruhrgebiet ein besonderes Interesse der Sieger. Seine Bodenschätze und sein Industriepotential machten es zu einem Sonderfall. Die drei Westalliierten und die Beneluxstaaten unterzeichneten nach sorgfältigen Beratungen am 28. April 1949 das »Ruhrstatut«. In diesem Abkommen wurde Deutschland die wirtschaftliche Verfügungsgewalt über das Ruhrgebiet entzogen. Die »Internationale Ruhrbehörde« hatte die Kohle-, Koks- und Stahlproduktion auf den internationalen und deutschen Markt zu verteilen. Sie bestimmte, daß ein Viertel der Kohleförderung zu exportieren sei, und zwar zu niedrigen Preisen. Westdeutschland mußte den fehlenden Bedarf durch amerikanische Importe ausgleichen, die erheblich teurer waren. Deutsche Kohle wurde im Herbst 1951 je Tonne zu 46 Mark verkauft, die amerikanische Importkohle -in gleicher Qualität - mußte dagegen je Tonne mit 145 Mark bezahlt werden. Durch dieses Zwangsverfahren der Ruhrbehörde ergab sich allein im Jahr 1950 ein Barverlust von 950 Millionen Mark.
Weg mit der Industrie, her mit der Industrie Die Marshallplan-Hilfe für Westdeutschland betrug rund sechs Milliarden Mark. Durch die Exportdekrete entstand dem deutschen Bergbau ein finanzieller Verlust in derselben Höhe. Außerdem war die Bundesrepublik das einzige Land, das die ERP-Hilfe nur als Kredite erhielt, also zurückzuzahlen hatte. Die Laufzeit betrug dreißig Jahre; doch die Summe war bereits nach drei Jahren abgetragen. Unter dem Strich blieb mithin ein gewaltiges Defizit zurück. Westdeutschland wäre ohne Marshallplan-Hilfe zumindest gleich gut, wenn nicht erheblich besser gefahren. Nun war freilich damit zu rechnen gewesen, daß die Sieger das Ruhrgebiet als Reservoir für ihre Reparationsforderungen betrachten würden. Daß wir jedoch für die ERP-Hilfe hätten »danken« sollen, war genauso ungewöhnlich, wie es Johannes Semler in seiner »Hühnerfutter-Rede« ausgedrückt hatte. Für das deutsche »Wirtschaftswunder« gab es nur zwei Gründe: Der eine ist in Ludwig Erhards genialem Konzept der sozialen Marktwirtschaft zu finden, der andere heißt »deutscher Fleiß«, - Fleiß in seiner härtesten Form. Westdeutschland erhielt aus dem Marshallplan pro Kopf 27,56 Dollar geliehen; es steigerte von 1948 bis 1951 sein Bruttosozialprodukt um 95 Prozent. Frankreich erhielt pro Kopf 66 Dollar geschenkt und steigerte im gleichen Zeitraum das Bruttosozialprodukt um 46 Prozent. In England betrug das Zahlenverhältnis 67 zu 22. Die folgenschwerste Lähmung der Politik des Wiederaufbaus, die der Marshallplan fördern sollte, bildete in Deutschland die Demontage der Industrie. In diesem Punkt äußerte sich die Konzeptlosigkeit der amerikanischen Politik in Deutschland besonders drastisch. Sowohl in Washington als auch bei der Militärregierung standen die verschiedensten Gruppen und widersprüchlichsten Meinungen gegeneinander. In den USA hatte schon früh eine Kommission, die der spätere Außenminister Christian Herter angeregt hatte, eindringlich vor allen Maßnahmen gewarnt, die sich als Weiterführung der Morgenthau-Plans in der US-Besatzungspolitik niederschlagen würden. Doch die Demontagen wurden in allen drei Westzonen fortgesetzt, auch dann noch, als das Pentagon die deutsche Remilitarisierung als unumgänglich erklärt hatte. Erst im Laufe des Jahres 1950 wurde die Demontage der deutschen Industrie endgültig eingestellt und wenig später auch die Zerstörung und der Abbruch aller Bauten, die militärischen Zwecke hätten dienen können. Rechtlich endeten die Demontagen erst nach der Unterzeichnung der Pariser Verträge vom 23. Oktober 1954. Ludwig Erhard schaffte 1950 einen Durchbruch, der für die Wirtschaft großartige Folgen hatte und für die Politik sehr fragwürdige. Die von dem Tempo des deutschen Wiederaufbaus irritierten USA verlangten damals, die Bundesrepublik solle ihre schrankenlose Wirtschaftsaktivität und den Konsum eindämmen. In Westdeutschland standen trotz der nach wie vor gültigen Forschungsverbote, Produktionsgrenzen und Zwangsexporte von Steinkohle alle Zeichen auf Expansion. Im Juli 1950 bemühte sich Erhard in Washington um eine Lockerung der Wirtschaftsfesseln. Amerika hatte damals mit dem Alptraum des Koreakrieges zu tun, der am 25. Juni ausgebrochen war. Der deutsche Wirtschaftsminister legte der US-Regierung eine Trumpfkarte auf den Tisch: Westdeutschland sollte gestattet werden, wieder mit der Rüstungsproduktion zu beginnen; die Güter würden nach Amerika geliefert. Der Vorschlag konnte sich weder auf die Zustimmung der Westdeutschen stützten, noch der Billigung der amerikanischen Bevölkerung sicher sein. Doch Erhard in Washington: Er kam, erklärte, triumphierte. Die US-Regierung fand sich zu mehr bereit, als Bonner Optimisten erhofft hatten. Ihren »Normalzustand« hatte die westdeutsche Wirtschaft -frei von allen Auflagen der Besatzungszeit - erst in der Mitte der fünfziger Jahre erreicht. Von diesem Moment an setzte eine unverhoffte Hochkonjunktur ein mit phänomenalen Wachstumsraten und einem Auftragsbestand, der ans Mysteriöse grenzte. Wen also hätte die Klage des »Daily Express« vom Januar 1954 über »die furchteinjagenden Fähigkeiten« des Deutschen Volkes erstaunen können?“
DIE GROSSEN EREIGNISSE Nach der Schlacht auf dem Amselfeld entschloß sich Sultan Beyazit L, endgültig mit den Resten des Byzantinischen Reiches aufzuräumen. Die osmanischen Truppen begannen im Jahr 1391 mit der Belagerung von Konstantinopel. Das Unternehmen mußte bald abgebrochen werden, jedoch nicht deshalb, weil sich Beyazit übernommen hätte. Die Rettung der Stadt und eine Atempause für Europa waren dem Mongolenchan Timur-Leng zu verdanken. Der Herrscher betrachtete sich als einen wiedererstandenen Dschingis Chan. Seine wiederholten Kriegszüge bis tief nach Syrien ließen den Osmanensultan nicht vergessen, was in Anatolien - inzwischen das Kernland seines Reiches - auf dem Spiel stand. Im Jahr 1400 fiel Timur an der Spitze einer ungeheuren Truppenmacht in Anatolien ein, stürmte die Stadt Sivas und schlachtete die gesamte Bevölkerung ab, an ihrer Spitze Ertoghrul, den Sohn Beyazits I. Zwei Jahre darauf kam es zu einer Entscheidungsschlacht zwischen beiden Herrschern. Das Heer des Sultans, zahlenmäßig unterlegen, wurde geschlagen, Beyazit gefangengenommen. Er verstarb 1403 in Akschehir, westlich von Konya. Der Mongolenchan gestattete, daß er nach Bursa überführt wurde, dem Ort, den die Sultane für ihre letzte Ruhestätte gewählt hatten. Die Mongolenschlacht des Jahres 1402 war die größte militärische Katastrophe der osmanischen Geschichte. Trotzdem hatte sie auf die Expansion des Osmanischen Reiches und seine Gestaltung nur eine mäßig bremsende Wirkung. Der innere Streit um das Erbe, begleitet von Aufständen, Separationsrevolten und Religionskämpfen zwischen den unterschiedlichen Bekennergruppen des Islam, dauerte ein Jahrzehnt, doch nach einem weiteren Jahrzehnt war das Reich wieder konsolidiert. Dieser großartige Erfolg war allein Sultan Mehmet I. zu danken, dem »Noah«, wie die osmanischen Historiker schrieben, »der die Arche des osmanischen Reiches rettete«. Mehmet I. verstarb 1421, sein Sohn Murat II. konnte in seiner dreißigjährigen Regierungszeit die noch bestehenden, gelegentlich aufflackernden Zwiste endgültig beheben. Allein auf dem Balkan vermochte er die Osmanenherrschaft noch nicht gänzlich in der früheren Form zu restaurieren, obgleich er 1444 bei Warna und vier Jahre später nochmals auf dem Amselfeld siegte. BRUDERMORD AUS STAATSRÄSON Die Nachfolge im Jahre 1451 trat Murats einundzwanzigjähriger Sohn Mehmet an. Der junge Sultan debütierte mit einer Aktion, die selbst für damalige Begriffe ungewöhnlich rücksichtslos war, bei der er sich aber auf das Beispiel berufen konnte, das die türkischen Großen in der Schlacht auf dem Amselfeld 1389 gegeben hatten, als sie nach der Ermordung Murats I. seinen Sohn Beyazit I. zum Sultan erhoben, vorher aber dessen Bruder Jakub Dschelebi töteten. So Mehmet II. umgehend seinen jüngeren Bruder Ahmet umbringen und damit von vornherein all die Erbstreitigkeiten aus, die seinen Vorgängern und« Staat so viel zu schaffen gemacht hatten. Seitdem wurde Brudermord nahezu i zwangsläufiger Reflex jedes Regierungswechsels im Osmanenreich. Diese i verwerfliche wie stabilisierende Maßnahme rief nach außen hin den Absehe* i insgeheim den Neid zahlreicher christlicher Herrscher Europas hervor. Mehmet l liebte auch sonst schnelle, eindeutige Entschlüsse. Kurz nach seinem Regier antritt mußte er eine Revolte des Fürsten von Karaman niederschlagen. Die Angelegenheit war nicht eben harmlos, weil dem Sultan auf der anderen Seat Kaiser Konstantin XII. Palaiologos drohte. Deshalb zog Mehmet II. nach Belegung der anatolischen Affäre umgehend an den Bosporus, setzte an der schmalsten Stelle über und ließ binnen weniger Monate das Fort Rumelihisar errichten. cmc Festung, deren Ausmaße schon in der damaligen Zeit als gewaltig empfunden wurden. Den Protest des Kaisers beantwortete der Sultan auf seine spezielle Art: Er ließ den Gesandten den Kopf abschlagen. Konstantinopel hatte als Machtmittel den türkischen Truppen nicht viel mehr als seine enorm starken Mauern, eine resigniert entschlossene Bevölkerung, die Gebete der Gläubigen und die Hilferufe des Kaisers nach Rom und dem Abendland entgegenzusetzen. Der Humanisten-Papst Nikolaus V. machte sein Interesse rad eine mögliche Hilfe davon abhängig, daß endlich die schon so lange Zeit angestrebte Union der beiden christlichen Kirchen verwirklicht würde. Kaiser Konstantin, der das Ausmaß der osmanischen Gefahr besser kannte als jeder andere Herrscher in Europa, wäre dazu bereit gewesen; doch die Bevölkerung von Byzanz weigerte sich, einen so hohen Preis für die militärische Unterstützung zu zahlen. Ihre Überzeugung wurde von dem Megas Dux Lukas Notaras, dem höchste Minister und Großadmiral des Kaisers, formuliert: »Es ist besser, in der Mitte der Stadt den Turban des türkischen Sultans zu sehen als die lateinische Mitra. « Der alleinseligmachende Glaube, gleichgültig welcher Färbung, war ein exorbitantes Motiv: Lieber tot, aber im richtigen Himmel, als »ketzerisch« auf Erden lebend und wenig später auch noch in der Hölle. Der Papst blieb ebenfalls unnachgiebig, zumal er die Nöte Konstantinopels nicht als seine größten Sorgen betrachtete. DIE BELAGERUNG Anfang April 1453 gab der Sultan das Zeichen zum Angriff auf die »Stadt der Städte«. Konstantin XII. verfügte nicht über genügend Truppen, um die mehr als zweiundzwanzig Kilometer langen Festungsmauern überall zu besetzen; andererseits galten die Fortifikationen an der Landseite mit ihrer dreifach tiefen Staffelung und dem mehr als fünfzehn Meter emporragenden inneren Ring als uneinnehmbar. Der Kern der Stadtmauer maß zwischen vier und fünf Metern, die sechsundneunzig Wehrtürme ragten zwanzig Meter in die Höhe. Konstantinopels Mauern gehörten zu den stärksten Befestigungen der damaligen Welt. Der Sultan hatte selbst viele Monate die Pläne für die Belagerung durchdacht und ausgearbeitet. Das Handikap der Osmanen bestand im Fehlen einer genügend schweren Artillerie, aber das betraf alle damaligen Armeen. Normalerweise wurden Festungen, die nicht im Sturm zu nehmen waren, ausgehungert. Konstantinopel war dafür zu groß, und vor allem ließen sich die Meereszufahrten nicht völlig blockieren. Die Einfahrt ins Goldene Hörn wurde durch eine riesige eiserne Kette gesperrt; sie hatte bis zum 22. April allen Durchbruchsversuchen türkischer Schiffe widerstanden und dadurch das Goldene Hörn, eine der schwächsten Stellen im Verteidigungsring, geschützt. Mehmet II. kam auf eine glänzende Idee. Er wußte nicht, daß schon lange vor ihm ein anderer Belagerer Konstantinopels denselben Einfall gehabt hatte. In der russischen Nestor-Chronik wird von Fürst Oleg berichtet: »Er befahl seinen Kriegern, Räder zu machen und auf diese Räder die Boote zu stellen. Und da sich ein günstiger Wind erhob, spannten sie die Segel auf und rückten vom freien Felde her an die Stadt heran. Als das die Griechen sahen, fürchteten sie sich und sandten Boten zu Oleg, die sprachen: >Vernichte die Stadt nicht; wir sind bereit, Tribut zu zahlen, wie du willst. < Da brachte Oleg seine Krieger zu stehen. « Mehmet II. befahl, große Tragbühnen auf Rollen zu bauen. Darauf wurden siebzig Schiffe vertäut, an Land gezogen und über den Berg an der Nordostseite des Goldenen Horns, oberhalb der heutigen Stadtteile Galata und Beyoghlu, gezogen. Die Christen der belagerten Festung glaubten in den Mittagsstunden des 22. April, der Teufel selbst sei am Werk gewesen, als in Riesenformation vollbeflaggte Osmanenschiffe mit gehißten Segeln den Berg hinab zum Goldenen Hörn und ins Wasser rollten, begleitet von Trommeln, Pfeifen, Fanfaren und dem Jubel der türkischen Truppen. Damit hatte der Sultan die Herrschaft über das Goldene Horn errungen.
Der byzantinische Historiker und Diplomat Georgios Phrantzes, der während der Belagerung selbst in Konstantinopel war und in türkische Gefangenschaft geriet beschreibt in seinem »Chronikon«, das er 1477 vollendete, die Eroberung Konstantinopels: DIE LETZTEN TAGE VON KONSTANTINOPEL Als der Frühling kam, schickte sich der Sultan zu dem Feldzug an, den er vorbereitet hatte, sammelte die Kanonen und Feldschlangen, die stellt worden waren, sandte dann den Pascha Charati mit einem Heere voraus und schließlich kam er selbst und schloß die Stadt ein. Noch vor dem Eintreffen des Sultans wurden die Kastelle und Türme außerhalb der Stadt, die und auf den Feldern zerstreut lagen und in die sich die Leute beim plötzlichen Anmarsch des Feindes geflüchtet hatten, nach kurzer Belagerung eingenommen; ein Teil der Leute wurde in die Sklaverei verkauft, einen Teil rafften die Seuche und die schlechte Behandlung hinweg. Es waren nicht wenig Christen, die damals in Gefangenschaft fielen. Inzwischen wurden Kriegsgeräte und Maschinen herbeigeschafft. Man brachte viele Kanonen, manche von solcher Größe, daß vierzig, ja manchmal sogar fünfzig Ochsengespanne und mehr oder auch zweitausend Menschen sie nicht ziehen konnten. Am 2. April kam der Sultan selbst, mit einer unübersehbaren Menge von Reitern und Fußsoldaten. Man errichtete ihm sein Zelt gegenüber dem Tore des heiligen Romanos, und das Heer breitete sich wie der Sand am Meer Umfassungsmauer von einem Ufer zum anderen aus. Im Laufe dieses Tages kam auch ein Teil seiner Flotte und ankerte nahe der Stadt an der Seeküste. Es waren etwa dreißig Trieren und Schnellruderer, an anderen Schiffen, Lastschiffen und Eindeckern aber einhundertdreißig. So näherte er sich der Stadt und begann sie auf alle Weise und mit allen Künsten zu belagern, indem er sie in einem Umfang von achtzehn Milien (Meilen) einschloß. Der Kaiser befahl, daß man die Eisenkette vor die Einfahrt in den Hafen lege, um das Eindringen der Flotte, ich meine der feindlichen Schiffe, zu verhindern. Innerhalb der Kette legte man alle verfügbaren Schiffe vor Anker, um die Sperre zu befestigen und von dort aus gegen die andringenden Schiffe der Feinde zu kämpfen. Es waren aber an Zahl die folgenden Schiffe: Drei aus Ligurien (Genua), eins aus Iberien, das heißt Kastilien, ... aus der französischen Provence, drei aus Kreta, und alle waren zum Kampf trefflich ausgerüstet. Es waren auch drei große venezianische Handelstrieren da, die die Italiener »galera grossa« oder »galeazza« nennen, und andere schnelle Trieren, die zum Schutz und zur Begleitung der Handelsschiffe dienten. Der Kaiser befahl, daß man auch sie zum Schütze der Stadt dabehalten solle. Das waren die Vorkehrungen, die man im Hafen traf; auf dem festen Lande aber stellten die Feinde die ganz große Kanone auf, deren Mündung zwölf Spannen breit war, und viele andere Kanonen von beträchtlicher Größe. Sie errichteten eine hohe Schanze mit Palisaden und schössen von dort aus und beschädigten die Stadtmauer an vierzehn Stellen sehr empfindlich. Am 15. desselben Monats lief der noch ausstehende Teil der türkischen Flotte aus dem Schwarzen Meer und aus dem Hafen von Nikomedia in Kleinasien ein, dreihundertzwanzig Schiffe an der Zahl, davon achtzehn Trieren und achtundvierzig Zweidecker, das übrige waren große Fahrzeuge und Lastschiffe, die eine Menge Fußsoldaten und Bogenschützen an Bord hatten. Es waren darunter auch fünfundzwanzig Kutter, die Holz, Kalk, Steine und anderes Belagerungsmaterial geladen hatten. Am zehnten des Monats war eine Musterung sowohl der Flotte als auch des Landheeres, der Reiter ebenso wie der Fußsoldaten, und es wurden an Schiffen aller Art, Trieren, Zweideckern, Eindeckern, Schnellruderern und Lastschiffen insgesamt vierhundertzwanzig Segel gezählt; das Landheer aber, das zum Kampf bereit stand, betrug achtundfünfzigtausendzweihundert Mann. Auf der Gegenseite standen zur Verteidigung der Stadt, so groß sie war, nur viertausendsiebenhundertdreiundzwanzig Mann bereit, außer den Fremden, die kaum zweitausend Mann ausmachten. Die genaue Zahl aber erfuhr ich aus folgender Ursache: Der Kaiser hatte den Hauptleuten und Heerführern befohlen, zusammenzuschreiben, wieviel in einem jeden Bezirk an kriegstauglichen Männern vorhanden seien, Weltliche und Mönche zusammengerechnet, und was für Waffen ein jeder besäße, um damit die Feinde abzuwehren; die Verzeichnisse hatten die Hauptleute dem Kaiser gegeben, und der sprach zu mir: »Das ist der rechte Auftrag für dich, denn er erfordert Verschwiegenheit und Geheimhaltung. Nimm die Verzeichnisse, setze dich nieder in deinem Hause und rechne zusammen, wieviele es sind und was sie an Waffen haben und Schilden, Bogen und Armbrüsten. « Als ich den Auftrag ausgeführt hatte, legte ich dem Kaiser die Summe vor, mit Betrübnis und Niedergeschlagenheit, und die Zahl blieb zwischen uns beiden geheim. Wir allein wußten sie. Der Sultan berief Leute, die sich darauf verstanden, unterirdische Minengänge zu graben, um auf diese Weise mit dem Heer in die Stadt einzudringen. Ein gewisser Johannes aber, ein Deutscher, der in Kriegskünsten sehr erfahren war und auch die Bereitung des flüssigen Feuers verstand, bemerkte dieses Vorhaben und grub eine Gegenmine, füllte sie mit flüssigem Feuer, ganz kunstgerecht, und als die Türken voller Freude kamen, um durch ihren Gang in die Stadt einzudringen, da legte er selbst die Lunte an das Feuer, das in der Gegenmine bereit lag, die er gegraben hatte, und verbrannte die meisten von ihnen und machte ihre Anschläge zunichte. Der Sultan machte sich an neue Erfindungen und Belagerungskünste: Er baute ein riesiges Belagerungsgerät aus dicken Balken, das auf vielen Rädern fuhr und sehr breit und sehr hoch war. Von außen und innen war es mit einer dreifachen. Schicht von Büffel- und Rindshäuten bekleidet und hatte Türme Schutzwände und Stiegen zum Hinauf- und Hinabsteigen, damit man die Mannschaft nicht treffen könne. Nach außen zu war es an einer Stelle offen, so daß man leicht ein- und aussteigen konnte, nach der Seite aber, mit der es an den Graben heranfuhr, hatte es drei große Türen, die mit Schutzwänden abgeschirmt waren. Darin waren alle Arten von Kriegsmaschinen sowie Hölzer und Balken, um sie in den Graben zu werfen, wenn es nottat, um so weiterkommen zu können. Es waren auch Strickleitern daran, die man herablassen und wieder aufziehen konnte. Als man dies Belagerungsgerät und alle möglichen Kriegsgeräte, auf die ein Menschenverstand gar nicht verfallen wäre und die der Kaiser gar nicht erwartet hätte, an die Mauern heranbrachte, half auch dies alles ihnen nicht einmal dazu, einen einzigen Wachturm einzunehmen. Sie hatten auch Kriegsgeräte, die mit flüssigem Feuer versehen waren, und machten sie bereit, um mit allen zugleich einen Ansturm zu versuchen. Zuerst schössen sie mit der großen, schrecklichen Kanone und trafen den Turm, der neben dem Turm des heiligen Romanos steht; den brachten sie zum Einsturz; dann zogen sie jenes Belagerungsgerät näher heran und stellten es über dem Graben auf, und es entstand ein grauenhaftes Handgemenge, und bis zur ersten Stunde der Nacht war der Sturm der Feinde abgeschlagen. Inzwischen, während die Stadt belagert wurde, kamen drei genuesische Schiffe, die in Chios Ladung genommen hatten und mit günstigem Winde auf uns zuhielten; auf der Fahrt hatten sie noch ein kaiserliches Schiff getroffen, das Getreide aus Sizilien brachte. Sie hatten sich in der Nacht der Stadt genähert, und als es nun Morgen wurde, bemerkten sie die Spähschiffe des Sultans; ein großer Teil der feindlichen Flotte begann Jagd auf sie zu machen, jubelnd und unter Pauken- und Hörnerschall, weil sie hofften, eine leichte Beute an ihnen zu haben. Als sie sie eingeholt hatten und den Kampf mit einer Beschießung eröffneten, war es das kaiserliche Schiff, auf das sie als erstes in ihrem Übermut losgingen. Sie wurden aber übel empfangen mit Kanonenschüssen, Wurfgeschossen und Steinen, und als sie mit dem Bug unter das Schiff anfuhren, da wurden sie, ohne entern zu können, mit Schüssen aus einem Mörser, der kunstgerecht mit flüssigem Feuer und Steinen geladen war, wieder zurückgetrieben, weil es so viele Tote bei ihnen gab. Der Sultan biß sich wie ein Hund in die Hände und stampfte wütend auf den Boden, weil er die Mauern zweimal und dreimal durchbrochen und die Gräben aufgefüllt hatte und doch wieder alles hergestellt worden war und weil hundert-fünfzig Trieren, Zweidecker und Eindecker die vier Schiffe nicht hatten fangen können. Und er dachte diese List aus, um einen Teil seiner Flotte in den inneren Hafen zu bringen; kaum ausgedacht, war sie auch schon ins Werk gesetzt. Hinten um Galata herum über den Hügel ebnete er eine Straße bis zum Hafen hinab, die er mit Hölzern und Bohlen belegte, welche er mit Rinder- und Widderfett glatt machte. Dann baute er mannigfache Maschinen und Vorrichtungen, mit denen er die Trieren und Zweidecker leicht auf die Höhe des Hügels hinaufziehen und dann wieder in Richtung zum Hafen hinablassen konnte. Es war eine bewunderungswürdige Sache und ein glänzendes Stück Seekriegskunst. So wurden die Schiffe in einer Nacht übergeführt, und als es Morgen war, fand man sie schon im inneren Hafen vor. Dann baute der Sultan eine Brücke auf folgende Weise: Boote, große Gefäße, hölzerne Fässer wurden ins Meer gelassen und mit Stangen, eisernen Ketten und Stricken aneinandergebunden, damit die Brandung den Bau nicht wieder zerstören könne; dann wurden oben auf die Boote und die Gefäße und die Fässer Bohlen gebunden und mit Nägeln befestigt, und so entstand eine starke, ansehnliche Brücke, die hundert Ellen lang und fünfzig breit war, so daß man mitten im Hafen wie auf festem Boden umhergehen konnte. Dann stellten sie eine Kanone auf der Brücke auf, und auch die Trieren begannen von dieser Seite her die Stadtmauern zu beschießen. Als sie das sahen, kam Verwirrung und Ratlosigkeit über den Kaiser und die ganze Stadt. Am Abend des 28. Mai hält der Sultan eine Ansprache an das Heer und verspricht allen hohe Belohnung, falls die Stadt bei dem bevorstehenden Sturme genommen werde. Sie hörten es und freuten sich sehr und riefen alle laut wie aus einem Munde: »La illaha illa llah, Muhammadun rasulu llah! « das heißt: »Es gibt keinen Gott außer Allah, und Muhammed ist sein Prophet. « Als wir in der Stadt diese laute Schreien vernahmen, wie das Rauschen eines gewaltigen Meeres, da forschten wir nach, was es zu bedeuten hätte. Aber bald erfuhren wir es als sichere, gewisse Kunde, daß der Sultan für den folgenden Tag zu Wasser und zu Lande einen Angriff auf die Stadt vorbereitete mit solcher Macht, wie es ihm nur irgend möglich wäre. Als wir aber die Menge der Ungläubigen betrachteten - ich sage es, wie ich es gesehen habe: Gegen jeden einzelnen von uns standen fünfhundert und noch mehr von ihnen -, da setzten wir unsere ganze Hoffnung nur mehr auf die Vorsehung da oben. Der König befahl, es sollten mit den heiligen, verehrungswürdigen Ikonen und Bildern Priester und Mönche, Frauen und Kinder weinend auf der Mauer die Runde um die Stadt machen und »Kyrie Eleison« singen und zu Gott flehen, daß er uns nicht wegen unserer Sünden in die Hände der gottlosen, abtrünnigen und verruchten Feinde ausliefere, sondern sich des ihm geheiligten Volkes erbarme. Der Kaiser hält Ansprachen an alle Führer der Truppen. Dann stiegen wir auf die Pferde und ritten vom Palast weg an den Mauern rundum, die Wachen zu sorgsamer Hut zu ermuntern und vom Schlafe abzuhalten. Alle waren in dieser Nacht auf den Mauern und auf den Türmen zur Stelle. Die Tore waren fest verrammelt, niemand konnte ein- oder ausgehen. Als wir zum Schuhmachertore kamen, zur Stunde des ersten Hahnenschreis, da stiegen wir von den Pferden ab und bestiegen den Turm; wir hörten von draußen viele Menschenstimmen und einen ständigen, großen Lärm, und die Wachen auf dem Turm sagten uns, daß es schon die ganze Nacht hindurch so gehe. Denn die Feinde zogen die Kriegsmaschinen, die sie zum Angriff auf die Mauern vorbereitet hatten, näher an die Gräben heran. Auch an der Küste waren die größten feindlichen Schiffe in Bewegung; die Trieren mit den Enterbrücken im Hafen fuhren näher an die Mauern und die Bollwerke heran. Beim zweiten Hahnenschrei fingen sie dann ohne irgendein Zeichen, so wie sie es auch an den Tagen vorher gemacht hatten, den Kampf mit großem Eifer und großer Macht wieder an. Im heftigen Kampf um die Mauer wird einer der Führer verwundet. Als der Kaiser erneut eine kurze Ansprache, in der er die Verteidiger zum Durchhalten ermunterte, gehalten hatte, wurde der Oberanführer Johannes Giustiniani durch einen Pfeilschuß am rechten Schenkel verwundet. Und als dieser erfahrene Kriegsmann das Blut aus seinem Körper rinnen sah, da wurde er ganz verändert. Er verließ seinen Platz und ging um einen Arzt. Keinerlei Anweisungen gab er den Seinigen, bestellte auch keinen Vertreter, um die Verwirrung und das Unheil zu verhindern, das dann hereinbrach. Denn als sich die Soldaten umwandten und ihren Führer nicht mehr sahen und es hieß, er sei geflohen, da kam auch über sie Furcht und Bestürzung. Die Türken aber faßten Mut, als sie die Verwirrung der Unsrigen sahen. Einer der Hassan, ein riesenhafter Mann, hob mit der Linken den Schild über den Kopf, zückte mit der Rechten das Schwert und ging auf die Mauer los, wo er die Verwirrung unter den Verteidigern bemerkt hatte. Dreißig seiner Gefährten folgten ihm, die es ihm an Mut gleichtun wollten. Diejenigen von den Unsrigen, die noch auf der Mauer geblieben waren, warfen nach ihnen mit Spießen und schleuderten Geschosse auf sie und wälzten riesengroße Steine hinab. Achtzehn wurden herabgestürzt. Aber Hassan kletterte empor, bis er oben auf der Mauer war und die Unsrigen von dort wegtrieb. Als ihm das gelungen war, da kamen auch Übrigen nach und erkletterten die Mauer. Die Unsrigen waren zu gering an der Zahl um sie rechtzeitig am Ersteigen der Mauer zu hindern, und es kamen immer mehr Feinde. Aber sie warfen sich auf die, die heraufgekommen waren, und töteten nicht wenige von ihnen. Hassan selbst wurde im Kampf von einem Stein getroffen und stürzte in die Tiefe. Da faßten die Unsrigen wieder Mut, und als sie ihn unten liegen sahen, warfen sie auf ihn Steine von allen Seiten. Er erhob sich auf das Knie und schützte sich, so gut es anging, aber von der Menge der Wunden wurden seine Arme schwach, und er wurde von den Geschossen verschüttet. Dann kam aber eine solche Menge von Feinden auf die Mauer hinauf, daß die die Unsrigen forttrieb, und sie bestürmten nicht mehr die Mauer, sondern drangen zum Tore hinein, so dicht, daß einer den anderen niedertrat. Da erhob innen und von außen und von der Richtung des Hafens her der Ruf: »Die Festung ist eingenommen, die Fahnen und Feldzeichen sind auf den Türmen aufgepflanzt! « Dieser Ruf brachte die Unsrigen zum Wanken und feuerte die Feinde an. Sie brachen in Geschrei aus und erstiegen ohne Scheu von allen Seiten die Mauer. Als dies der unglückliche Kaiser, mein armer Herr, sah, da rief er Gott um Hilfe an und ermahnte die Krieger zu großherzigem Ausharren. Denn es war keine Hoffnung mehr auf Zuzug oder Unterstützung. Er trieb sein Pferd an und ritt gerade dorthin, wo die dichteste Schar der Feinde im Andringen war, und er tat, wie es Samson mit den Philistern gemacht hat: Eine große Menge von ihnen riß er von der Mauer herab und brachte sie zum Sturze, daß es wie ein Wunder anzusehen war. Brüllend wie ein Löwe und das gezogene Schwert in der Rechten, schlug er viele von den Feinden nieder, Von seinen Händen und von seinen Füßen rann das Blut in Strömen herab. Und auch Don Francisco aus Toledo benahm sich wie ein zweiter Achilles. Er stand rechts vom Kaiser und stieß auf die Feinde nieder wie ein Adler, der seine Beute mit dem Schnabel und den Fängen packt. Auch Theophilos Palaiologos, als er den Kaiser im Handgemenge und die Stadt in so großer Gefahr sah, rief klagend mit lauter Stimme: »Ich will lieber sterben als am Leben bleiben«, warf sich mit Kampfgeschrei mitten in die Feinde und vertrieb, zerstreute und erschlug, soviele er nur konnte. So töteten sie viele Feinde, bevor sie selbst sterben mußten. Ich aber war zu dieser Stunde nicht bei meinem kaiserlichen Herrn, da ich auf sein Gebot die Aufsicht in einem der Stadt zu führen hatte. So waren am dritten Tage die Feinde im Besitze der ganzen Stadt; es war halb neun Uhr vormittags, am 29. Mai des Jahres 1453. Die Eindringlinge plünderten und machten Gefangene, die Überrumpelten, die sich widersetzten, wurden erschlagen. An manchen Orten war die Erde nicht mehr zu sehen vor lauter Toten, die umherlagen. Es war ein schrecklicher Anblick, jammervoll anzusehen, wie sie unzählige Gefangene aller Art wegführten, vornehme Damen, Jungfrauen und gottgeweihte Nonnen, und wie sie sie an den Haaren aus den Kirchen herauszerrten, unter fürchterlichem Jammergeschrei, dazu das Weinen und Heulen der Kinder, die entweihten heiligen Orte - wer könnte all das Grauen beschreiben? Das heilige Blut und der heilige Laib Christi wurden auf den Boden geworfen und vergossen, die heiligen Gefäße, darin sie gewesen waren, rissen sie an sich, einige zerschlugen sie, andere steckten sie im Ganzen ein; auf den heiligen Ikonen, die mit Gold, Silber und Edelsteinen verziert waren, traten sie herum, nahmen den Schmuck davon ab und verwendeten sie als Sitzgelegenheiten und als Tische, auf denen sie aßen; mit den heiligen Gewändern, die aus golddurchwirkter Seide gefertigt waren, bekleideten sie ihre Pferde, die Perlen von den Reliquienkästen raubten sie, traten die Gebeine der Heiligen mit Füßen und taten noch viel anderes Beklagenswertes, als wahre Vorläufer des Antichrist.
Sultan Mehmet II. - von diesem Tage an »Fatih«, das heißt »der Eroberer«, genannt - hatte erst gegen Nachmittag die Stadt betreten. Langsam ritt er an der Spitze seiner Janitscharen - Leibwache durch die Straßen, nachdenklich und ergriffen: Ihm war der höchste Sieg des Islam zugefallen. Er hatte nicht nur die Hauptstadt des christlich-byzantinischen Staates erobert, er durfte sich jetzt auch als Erbe dieses Reiches betrachten, als Nachfolger der Cäsaren und Kaiser. Denn Konstantinopel lag sowohl in Asien als auch in Europa, und zwar nicht nur symbolisch. Der Sultan konnte mit Recht seinen Titeln einen neuen hinzufügen; »Herr zweier Erdteile und zweier Meere«. Er ritt direkt zur Hagia Sophia, der Kathedrale des Basilaios, und nahm sie feierlich für den Islam in Besitz. Dann betrat er den alten Kaiserpalast, ging durch die verlassenen Hallen und Säle, fern aller schäumenden Triumphgefühle, denn er entsann sich des mythischen Ahne» seines Volkes; er zitierte einen alten persischen Vers: Die Spinne webt die Vorhänge im Palast der Cäsaren, Die Eule ruft von den Türmen Afrasiyabs die Stunden aus. Das Bewußtsein von diesem welthistorischen Augenblick durchdrang auch den christlichen Teil Europas, als der Fall Konstantinopels bekannt wurde. Dabei hielten sich das Entsetzen über den »zweiten Tod Homers und Platons« — so stöhnte Enea Silvio Piccolomini -, über das Ende des christlichen Byzanz und die schlagartig wachsende Furcht vor der osmanischen Bedrohung, besonders akut im ungarischen Raum, die Waage. Alle erneuten Kreuzzugsvorhaben zerschlugen sich jedoch schnell. Kaiser Friedrich III. hatte keine Illusionen und kein Geld, Karl V. nach dem Hundertjährigen Krieg keine Kräfte, England keine Zeit, da es mit seiner Selbstzerfleischung in den Rosenkriegen beschäftigt war, keiner in Italien hatte andere Interessen als die Handelsverbindungen, und Philipp der Gute von Burgund, auf den das alles nicht zutraf, raffte sich 1454 lediglich zu einem ungeheuren Festmahl in Lüttich auf, bei dem ein lebender, völlig mit Diamanten behängter Fasan zur Tafel getragen wurde und alle anwesenden Ritter einen neuen Kreuzzug beschworen. Dieses Fasanengelübde wurde viel bestaunt, noch mehr beredet, von den Chronisten notiert - doch erfüllt wurde es nicht. Die eingefügten Bilder zeigen die Hagia Sophia sowie Mehmet II. Der Eroberer.
Ein Querkopf braucht kein Alibi – Szenen der Geschichte Polarstern des demokratischen Willens, leicht verkürztes Kapitel „Polarstern des demokratischen Willens“ aus dem Buch „Ein Querkopf braucht kein Alibi – Szenen der Geschichte, sowie erschienen in: Geschichte Nr. 1 1991 Jan./Feb., Archiv Verlag, Braunschweig. |
|
[Home] [Bücher] [Herausgeber] [Erhältliche Titel] [Artikel] [Kontakt] |
 Seit Beginn der Belagerung wurden die großen Landmauern im Westen Konstantinopels Tag und Nacht beschossen. Ununterbrochen mußten die Verteidiger die Breschen ausbessern. Hätten die Osmanen nur über die gewöhnlichen Geschütze verfügt, dann wäre auch dieser Dauerbeschuß ohne besondere besondere Wirkungen geblieben. Schwere Verwüstungen entstanden jedoch durch die Kanone eines ungarischen Geschützgießers, die Mehmet eigens hatte bauen lassen. Ihr Abschuß war zwanzig Kilometer weit zu hören; die Kugeln wogen mehr als eine halbe Tonne. Der Name »Baliamezza«, unter dem dieses riesige Geschütz bekannt wurde, ist eine Europäisierung der türkischen Bezeichnung »Balyemez« - die Kanone die keinen Honig aß«. Am 29. Mai 1453 frühmorgens drangen die ersten Soldaten durch eine Bresche in die Stadt, die von einem der monströsen Geschosse stammte.
Seit Beginn der Belagerung wurden die großen Landmauern im Westen Konstantinopels Tag und Nacht beschossen. Ununterbrochen mußten die Verteidiger die Breschen ausbessern. Hätten die Osmanen nur über die gewöhnlichen Geschütze verfügt, dann wäre auch dieser Dauerbeschuß ohne besondere besondere Wirkungen geblieben. Schwere Verwüstungen entstanden jedoch durch die Kanone eines ungarischen Geschützgießers, die Mehmet eigens hatte bauen lassen. Ihr Abschuß war zwanzig Kilometer weit zu hören; die Kugeln wogen mehr als eine halbe Tonne. Der Name »Baliamezza«, unter dem dieses riesige Geschütz bekannt wurde, ist eine Europäisierung der türkischen Bezeichnung »Balyemez« - die Kanone die keinen Honig aß«. Am 29. Mai 1453 frühmorgens drangen die ersten Soldaten durch eine Bresche in die Stadt, die von einem der monströsen Geschosse stammte.
 Als die Stadt eingenommen war, zog der Sultan in sie ein und befahl, nach dem Kaiser mit allem Eifer nachzuforschen. Er hatte keinen anderen Gedanken in Sinn, als zu erfahren, ob der Kaiser am Leben geblieben oder tot sei. Einige kamen und sagten, er sei entkommen, andere behaupteten, er sei irgendwo in der Stadt versteckt, wieder andere, er sei im Kampfe gefallen. Der Sultan wollte Genaues erfahren und sandte Leute dorthin, wo die Leichen der Gefallenen in großen Haufen lagen, Christen und Ungläubige durcheinander. Man wusch die Köpfe vieler Toter, um etwa die Gesichtszüge des Kaisers zu erkennen. Aber man erkannte das Gesicht des Kaisers nicht, sondern nur den Leib, und zwar an dem kaiserlichen Schuhen, die mit goldenen Adlern bestickt waren, wie es auf kaiserlichen Gewändern üblich ist. Da freute sich der Sultan sehr und befahl, die Christen, die gerade zugegen waren, sollten den Leichnam des Kaisers mit den gebührenden Ehrenbezeigungen begraben. Ach, ach, welche Zeiten hat mich die Vorsehung Gottes erleben lassen! Aber die gesamte Lebenszeit des ruhmreichen, gütigen Kaisers und Märtyrers hat neunundvierzig Jahre, drei Monate und … Tage betragen.
Als die Stadt eingenommen war, zog der Sultan in sie ein und befahl, nach dem Kaiser mit allem Eifer nachzuforschen. Er hatte keinen anderen Gedanken in Sinn, als zu erfahren, ob der Kaiser am Leben geblieben oder tot sei. Einige kamen und sagten, er sei entkommen, andere behaupteten, er sei irgendwo in der Stadt versteckt, wieder andere, er sei im Kampfe gefallen. Der Sultan wollte Genaues erfahren und sandte Leute dorthin, wo die Leichen der Gefallenen in großen Haufen lagen, Christen und Ungläubige durcheinander. Man wusch die Köpfe vieler Toter, um etwa die Gesichtszüge des Kaisers zu erkennen. Aber man erkannte das Gesicht des Kaisers nicht, sondern nur den Leib, und zwar an dem kaiserlichen Schuhen, die mit goldenen Adlern bestickt waren, wie es auf kaiserlichen Gewändern üblich ist. Da freute sich der Sultan sehr und befahl, die Christen, die gerade zugegen waren, sollten den Leichnam des Kaisers mit den gebührenden Ehrenbezeigungen begraben. Ach, ach, welche Zeiten hat mich die Vorsehung Gottes erleben lassen! Aber die gesamte Lebenszeit des ruhmreichen, gütigen Kaisers und Märtyrers hat neunundvierzig Jahre, drei Monate und … Tage betragen.