|
|
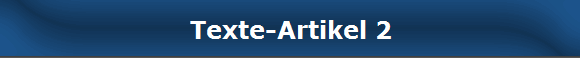 |
||||
|
|
||||
|
Texte von Artikeln Teil 2 Untenstehend findet sich der vollständige Text der folgenden Artikel: Treu solange es geht, in: Rheinischer Merkur, 01.04.1988. Pennäler-Frage seit Olims Zeit: Was soll ich mit Methusalem? in: Die Welt, 14.06.1988. Gelebtes Wissen: Geschichte gibt dem Charakter Profil, in: Die Welt, 15.06.1988. Ein Heidegger im Olympiakader, Inbegriff der Renaissance, aber auch Inspiration für das heutige Lebensgefühl: Leon Battista Alberti, Kapitel „Logik der Leistung“ aus dem Buch „Geschichte macht Mut“, sowie erschienen in: Die Welt, Geistige Welt, 11.03.1989. Wahrheiten, in: Die Welt, Nr. 270, 18.11.1989. Der Umbruch am Ende des Jahrhunderts, in: Handelsblatt, Signatur der Zeit Nr. 158, Düsseldorf, 17./18.08.1990. Dieser im Handelsblatt erschienene Beitrag ist das leichtgekürzte Schlußkapitel aus dem sechsbändigen Werk „DIE GROSSEN EREIGNISSE“. Polarstern des demokratischen Willens, leicht verkürztes Kapitel „Polarstern des demokratischen Willens“ aus dem Buch „Ein Querkopf braucht kein Alibi – Szenen der Geschichte”, sowie erschienen in: Geschichte Nr. 1 1991 Jan./Feb., Archiv Verlag, Braunschweig.
Treu solange es geht, in: Rheinischer Merkur, 01.04.1988. Stolperstein der Routine im Supermarkt: Die Frau an der Kasse: „Viel Geld für Hundefutter.“ Die Kundin: „Warum nicht?“ Die Frau an der Kasse: „Sicher. Hunde sind wenigstens treu." Da merkt man auf. Die Frau hat eines jener Durchschnittsgesichter, deren Reiz dem Druck der Jahre soeben unterliegt. Die Augen aber sprechen, wissende, mithin bekümmerte Augen. Ob sie selbst einen Hund hat? Die Folgerung, daß ihrer Bemerkung eine tiefe Enttäuschung zugrunde liegt, ist wahrscheinlicher. Zumindest dürfte sie sich den Hund, falls sie wirklich einen besitzt, eben deshalb angeschafft haben. Am einfachsten wäre es natürlich, sie zu fragen. Aber an der Kasse eines Supermarkts zahlt man die Rechnung und betreibt keine Gemütsforschung. Zumal bei Unbekannten. Doch der Satz bleibt hartnäckig hängen. Die Kassiererin hat die Neutralität der Dienstleistung durchbrochen, hat einen Moment die Jalousien ihrer Privatsphäre geöffnet. Sie leidet offensichtlich noch immer so sehr unter der Treulosigkeit eines nahestehenden Menschen, im Zweifelsfall eines Mannes, daß ihr die Bemerkung fast ungewollt entschlüpft ist. Eine betrübliche Sache, aber Teil der banalen Alltäglichkeit. Soll man deshalb einen einzigen Gedanken daran verschwenden? Insbesondere heutzutage, da die Treue weder in der Theorie noch in der Praxis des Verhaltens eine wesentliche Rolle spielt. Hat der Begriff nicht etwas Angestaubtes, beinahe Absurdes? Treue als Charaktereigenschaft, Treue zum Gemeinwesen, zum Kollegen, zum Partner, zum Geliebten? Allenfalls zu sich selbst, verstanden als Egoismus. Weil sich die Kassiererin nicht an Marlene Dietrich halten kann und ihren Rat, nicht zu weinen, „wenn man auseinandergeht, da an der nächsten Ecke...“, muß sie sich mit unserer hilfreichen Justiz begnügen? Irritationen, die eine Beziehung, also auch eine Ehe, zerstören, haben nichts mit „Schuld“ zu tun. Oder? Die katholische Kirche betrachtet die Ehe nach wie vor als ein Sakrament. Die feierliche Formel der kirchlichen Trauung „ ... bis daß der Tod euch scheidet“ hat auch heute noch etwas überaus Eindrucksvolles, freilich auch Altertümelndes – zumindest für Leute, die den Mut zur Bindung, einschließlich der unbekannten Risiken des Künftigen, nicht besitzen. Da wundert es kaum noch, wenn im Zeichen der sogenannten „offenen Ehe“ auch schon von Kirchenleuten empfohlen wird, die frisch Getrauten nur so lange auf das Miteinander und die Treue festzulegen, „solange es gutgeht“. Das fügt sich in unsere bundesrepublikanische Atmosphäre, in der schon allerlei Unverfrorenheit dazugehört, die Grenzen zwischen der Welt der Liberalität und der Welt der Libertinage beim Namen zu nennen. Wer hierzulande so unklug ist, derartiges zu versuchen, der verstößt gegen unsere unveräußerlichen Menschenrechte auf Freiheit, Toleranz, Selbstentwicklung oder wie die Mäntelchen der modernen Mediokrität heißen mögen. Er rückt große Errungenschaften des Fortschritts ins Zwielicht. Der Staatsanwalt läßt grüßen, oder zumindest jene Medienwächter, die mit den Dingen der individuellen und öffentlichen Moral so leicht zungenfertig werden. Die Treue gehört zu den ältesten Wertvorstellungen des Menschen. Sie war einmal Rückgrat seiner Selbstachtung: Ein treuloser Mensch galt als ehrloser Mensch. Nun gut, man mag den Grundbestand der einfachen, alltäglich gefragten „Sittlichkeit“, den selbstverständlichen Anstand einschätzen wie man will, doch was soll man tun, wenn alle Vorsätze von der Liebe über den Haufen geworfen werden? Von der tatsächlichen Liebe und ihrem Aufruhr, also nicht von dem, was wir zumeist nur dafür halten und was kaum den Rang einer physiologischen Wallung erreicht. Ist auch dann die Treue eine Frage der Definition? Wenn heute im Zeichen des Pluralismus selbst das Minimum eines normativen Grundbestandes fragwürdig geworden ist, dann wird es bei der „Liebe“ hoffnungslos. Da herrschen Worte wie: wenn und aber, vielleicht, möglicherweise, sowohl als auch - mit diesem Morast von Mutmaßungen und Konjunktiven kann man nicht anders fertigwerden, als darin zu versinken. Liebe? Das umfaßt zur Zeit alles: von der himmlischen Nacht bis zur Himmelsmacht. Das Lexikon zieht sich, wie sollte es anders sein, mit Plattheiten aus dem Dilemma: Liebe sei der Sammelbegriff einer Vielzahl von Gefühlsbindungen, „denen die rational nur unvollständig begründbare Wertbejahung eines Objektes zugrunde liegt.“ Der Verfasser scheint von dem, was er da zu definieren versucht, noch nie geschüttelt worden zu sein. Oder wenn doch, dann behilft er sich mit dem Alibi der angeblich überwiegend polygamen Natur des Mannes und seiner Sexualität, die - ebenfalls angeblich - mit seinem Gemüt, seinem Empfinden, seiner Seele ungleich weniger intensiv verbunden sein soll als bei der Frau. Anders gesagt: In Sachen Liebe soll die Treue wesentlich nur zur Frau gehören. Ein treuer Mann wäre die Verkörperung einer Unwahrscheinlichkeit: Locus impossibilitatis. Womit sich die Kategorie Mann augenzwinkernd des sittlichen Freibeutertums versichert hätte. Selbst die Medizin stützt dergleichen, wenn sie den Mann in Angelegenheiten der „Liebe“ als Sklaven seiner Körperchemie deutet. Immerhin nur der Liebe in Anführungszeichen. Die entschiedensten Interpreten der Verhaltensvorschriften, die sich im Zusammenhang der Liebe mit der Moral ergeben, sind die katholischen Theologen. Sie besitzen allerdings nicht mehr dieselbe Sicherheit wie vor einem Jahrhundert - eine Folge der selbstkritischen Einsicht, daß dem Sexualtrieb und der Urgewalt der Liebe mit Hilfe einer religiösen Abwertung nicht beizukommen ist. Nichts ändert sich dadurch am Imperativ der Treue, nichts auch am Wertgegensatz zwischen Liebe und Treue, der so bedrückend werden kann. Und deshalb wohl die stumme Klage in den traurigen Augen der Kassiererin des Supermarkts. Ihr Leiden an der Untreue signalisiert, daß die ursprüngliche Bindung zwischen ihr und dem anderen eine Anwartschaft auf Zuverlässigkeit, Beständigkeit, Beharrung der Gesinnung einschloß, die nicht zerbröseln würde unter den natürlichen Belastungen der Monate und Jahre und ihres Wechsels. Sie hat die gegenseitige Treue mit der Substanz des Mannes und ebenso mit ihrer eigenen verbunden. Ist sie nur deshalb einer Illusion aufgesessen, weil es heute kaum noch klare Entscheidungen über die Rangordnung und die Werte gibt? Ist Treue zu einer Person, einer Sache, einem Gemeinwesen zugunsten einer generellen Ichbezogenheit ins Abseits geraten? Das kann man sich wortgewandt beweisen. Und doch bleibt der Verdacht, den wir insgeheim mit der Kassiererin teilen: daß nur Hunde wirklich treu sind. Wahrscheinlich auch der Hund, auf den unsere Vorstellungen von den inhaltlichen Werten und ihrer Bedeutung gekommen sind.
Pennäler-Frage seit Olims Zeit: Was soll ich mit Methusalem? Die Kultusminister haben sich darauf geeinigt, für das Fach Geschichte Mindeststandards zu entwickeln. Im fünften Teil der WELT – Serie analysiert der Historiker Hellmut Diwald bisherige Versäumnisse und gibt Anregungen dafür, wie ein solcher Stoff-Kanon aussehen könnte, in: Die Welt, 14.06.1988. Pennäler-Frage seit Olims Zeit: Was soll ich mit Methusalem? Seit Jahren klagen bei uns die Experten und Fachhistoriker, Pädagogen und freiberuflichen Wächter der Kultur über den Verfall der Geschichtskenntnisse. Es ist noch nicht lange her, daß die Ergebnisse einer Schülerumfrage bundesweit kommentiert wurden - teils amüsiert, teils entsetzt, teils voller Endzeitgefühle hinsichtlich einer Bildungsausstattung, welche die Bundesrepublik als ein Land ohne Schulpflicht erscheinen läßt. Allerdings war das Echo nicht nur wegen der dürftigen Geschichtskenntnisse so laut, sondern auch wegen der kuriosen Antworten: Da hatte etwa Adenauer die NSDAP gegründet, Hitler war CSU-Vorsitzender in Bremen, Bismarck erklärte 1914 Frankreich den Krieg, und Friedrich der Große triumphierte bei Waterloo über Napoleon. Hatten die Schüler den Spott verdient? Oder die Lehrer? Oder die Kultusminister, aus deren Amtsstuben die Richtlinien des Unterrichts und die Stundenzahlen kommen? Was berechtigt die Universitäten ganz allgemein zur Arroganz über die ungenügenden Kenntnisse der Abiturienten und speziell die Historiker zu ihren Lamentationen über das klägliche Geschichtswissen der Erstsemester? Darf man von einem Schüler erwarten, daß er mehr weiß, als er auf der Schule gelernt hat? Die Frage „Warum überhaupt Geschichte?" steht hier nicht zur Debatte. Setzen wir einmal voraus, was nicht in allen Bundesländern selbstverständlich ist: daß Stunden in diesem Fach so selbstverständlich zum Schulunterricht gehören wie Mathematik-, Deutsch-, Geographie- oder Biologiestunden. Gehen wir auch davon aus, daß inzwischen die Begründungen für den Geschichtsunterricht oder seine Anfeindungen niemanden mehr so recht hinter dem Ofen hervorlocken. Der Trend, zumal der kultusministeriell abgesegnete, läuft heute darauf hinaus, in allen Bundesländern den Geschichtsunterricht als eigenes Fach wieder obligatorisch zu machen und ebenso eine Erhöhung der Stundenzahl anzupeilen. Ist es allein damit getan? Seit Jahren erledigen Erstsemester die Frage, wie denn ihr Geschichtsunterricht an der Schule war, mit einem einzigen Wort: langweilig -, die Unbefangenen benützen Vokabeln der Disco-Szene. Liegt es an den Lehrern? Jeder von uns erinnert sich an die pädagogisch Begnadeten, die den abstraktesten oder entlegensten Stoff so meisterhaft unterrichten können, daß die Schulstunde ein Abenteuer wird. Solche Lehrer sind Ausnahmen, sie werden nie die Regel sein, an ihnen darf man also auch nicht messen. Die Geschichte der Menschen, Völker, Staaten ist turbulent, mörderisch, glanzvoll, abstoßend, großartig, deprimierend - sie ist aber niemals langweilig. Deshalb darf und muß man vom Geschichtslehrer erwarten, daß sein Unterricht vom Leben der Geschichte bestimmt wird. Wer die Dramatik des Stoffes ausfiltert und den Rest als Schlafmittel verkauft, darf sich nicht wundern, wenn die Klasse gähnt. Entscheidend ist dabei die Altersstufe. Zwölfjährigen ist nicht das Abstraktionsvermögen der Oberstufen zuzumuten. Solche Verstöße gegen das natürliche Interesse und die Neugier von jungen Menschen sind Todsünden gegen den Geist der Pädagogik. Im Katalog der unentschuldbaren Verstöße gegen eine erfolgreiche Geschichtsvermittlung gibt es zwei Kardinalverbrechen. Das erste besteht darin, den Geschichtsunterricht in den Dienst offener oder verkappter politischer Erziehung zu stellen und mit einer bestimmten Form der historischen Interpretation zu verbinden - kaschiert durch das Etikett „Erziehung zum mündigen Bürger“ und durch das Versprechen, wie es in einer „Vereinbarung der Kultusministerkonferenz“ heißt, „die Erziehung des Schülers zu geistiger Selbständigkeit und Verantwortung zu fördern. Durch solchen Dienst wird die Geschichtskenntnis um ihren Selbstwert gebracht. Im Unterricht zeigt sich das in der Auswahl der Stoffe: Soziale Mißstände, Unmenschlichkeit des Strafvollzugs - die Geschichte strotzt von solchen Übelständen, aber das ist nur einer ihrer vielen Aspekte. Wird er isoliert, muß sich die ganze Historie verwandeln, in eine Geschichte der Übelstände. Dann präsentiert sich Historie tatsächlich nur als Variante eines Polizeiberichts. In einer solchen Perspektive zeichnet sich der Herrscher durch Cäsarenwahnsinn von Gottes Gnaden aus, das Königtum durch seine Mätressenwirtschaft, die katholische Kirche durch ihre Ablaßpraxis, der Staat durch seine Raubkriege, die christliche Religion durch die Hexenverfolgungen, und so weiter. Das zweite Kardinalvergehen besteht darin, den Verlauf der Geschichte, den Zusammenhang des Geschehens zu zerschlagen. Statt des chronologischen Durchgangs" erhält der Schüler vereinzelte Blöcke vorgesetzt mit Titeln wie „Herrschaft und Gesellschaft", „Sozialisation" oder „Monarchie und Imperialismus". Im Zuge des exemplarischen, problemorientierten, emanzipatorischen, operationalisierten Geschichtsunterrichts bekommt er einen „Mischmasch mit Methode" zu spüren; von der Historie spürt er nichts, dafür von Fallstudien und Modellen, Strukturen und Strategien. Wer die Verkettung der Ereignisse aufgibt, zerschlägt ihren Sinnzusammenhang und die entscheidende Möglichkeit der Orientierung. Geschichte ist ein großartiges Abenteuer, aber das Pauken der Geschichtsvokabeln, nämlich das simple Auswendiglernen einer Mindestanzahl von Grunddaten ist weder großartig noch abenteuerlich; doch ohne Daten kein Geschichtswissen. Nur: Wer Französisch lernt, der weiß daß er mit den Vokabeln allein die Sprache noch nicht beherrscht. Das gelingt erst mit Hilfe der Grammatik und ausdauernder Übung. Genausowenig erschöpft sich das Geschichtswissen mit der Kenntnis historischer Daten. Was die Grammatik für die Sprache ist der Zusammenhang für die Geschichte. Die „ausdauernde Übung“ schließlich besteht darin, daß der Schüler lernt, die Daten, Personen und Ereignisse nicht einfach nur in ihrem Zusammenhang zu sehen, sie dort einzuordnen und wie einen Rosenkranz herzubeten, sondern daß er auch ihre unterschiedlichen Beziehungen kennt, ihre Querverbindungen, Abhängigkeiten und Wirkungen. Das alles waren und sind Selbstverständlichkeiten für einen normalen, das heißt effektiven Geschichtsunterricht. In unseren Schulen aber wird das nur in Ausnahmefällen als selbstverständlich angesehen.
Gelebtes Wissen: Geschichte gibt dem Charakter Profil. Das T-Shirt der geistigen Beschränkungen soll nun abgelegt werden: Die Kultusminister haben eine Verbesserung des Geschichtsunterrichts auf der gymnasialen Oberstufe beschlossen. Fachliche Einzelheiten müssen aber noch beraten werden. Zum Abschluß der WELT – Serie sagt der Erlanger Historiker Hellmut Diwald, was Pflichtstoff sein sollte, in: Die Welt, 15.06.1988. Gelebtes Wissen: Geschichte gibt dem Charakter Profil. Wer Vorschläge für eine Reform des Geschichtsunterrichts unterbreitet, kommt nicht ohne einige Voraussetzungen aus, die er machen muß. Nehmen wir an, die wenigen Geschichtsstunden würden den in anderen Fächern als gleichrangig eingestuft und dienten nicht mehr bevorzugt als Ausfall-Stunden; nehmen wir ferner an, daß die Geschichtslehrer sich mit ihrem Fach identifizieren, sich also nicht mehr quasi für die Tatsache entschuldigen, daß sie es unterrichten; nehmen wir schließlich an, daß der Geschichtsunterricht nicht mehr vom Joch gesellschaftspolitischer Lernziele verdreht, sondern so abgehalten wird wie jedes andere Fach. Die Gretchenfrage lautet dann: Was muß ein Abiturient aus der Historie wissen? 1. Der Abiturient muß etwas von seiner eigenen Geschichte wissen; hier liegt der natürliche Ausgangspunkt, Zur eigenen Geschichte besteht aufgrund der Sprache, der Überlieferungen, der Herkunft ein unmittelbarer Zugang. Ausgehend von der Geschichte des Ortes, in dem sich die Schule befindet, läßt sich ohne weiteres die Verbindung zur Region und dem jeweiligen Bundesland sowie zum größeren Verband des Staatswesens der Gegenwart und seiner besonderen Art der Gesellschaft nachvollziehen. 2. Er muß die Grundtatsachen der politischen Situation der Bundesrepublik wissen: Ihre Entstehung, ihr Verhältnis zu jenem Westeuropa, das heute diesseits der Elbe „Europa" genannt wird. Desgleichen ihr Verhältnis zur DDR, das Gesellschaftssystem der DDR, ihr Verhältnis zur Sowjetunion und den anderen sozialistischen Staaten. 3. Er muß Deutschland und seine Geschichte innerhalb Europas während des 20. Jahrhunderts kennen: Die Mächtekonstellation vor dem Ersten Weltkrieg, den Anlaß des Ausbruchs, die Gründe für die Allianzen, die Kriegsziele, die Hauptdaten des Verlaufs, die Friedensregelungen von Versailles, die Weimarer Republik (innenpolitische Probleme, Außenbeziehungen), den Völkerbund und die Staaten Europas seit 1919, das Ende der Weimarer Republik (Folgen der Weltwirtschaftskrise, die politischen Parteien), den Nationalsozialismus bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, den Verlauf des Krieges in Hauptzügen, 1945 und die alliierten Sieger. 4. Das 20. Jahrhundert ist trotz seiner turbulenten Ereignisse und der zahlreichen Umbrüche in weitestem Sinn unsere Gegenwart. Im Unterschied dazu empfanden sich die Menschen am Ende des 19. Jahrhunderts keineswegs noch in Tuchfühlung mit den Zeitgenossen der Ära Napoleons. Der Schüler muß das Gespür für die Eigenart historischer Epochen, für das Besondere der geschichtlichen Zeit im Unterschied zur bloßen Chronologie entwickeln. Deshalb steht die Kenntnis des 20. Jahrhunderts am Beginn des Grundwissens. Vor diesem Hintergrund muß er das Panorama der großen Zeitalter der Weltgeschichte kennenlernen, sowohl ihre religiöse, kulturelle und politische Eigenart als auch ihr Verhältnis zueinander: Griechenland (von Homer bis Alexander dem Großen). Rom (Gründung, Republik, punische Kriege, Kaiserzeit, Germanien). Entstehung und Triumph des Christentums. Die Religionen, Kulturen und Staatsbildungen außerhalb Europas (Ägypten, Persien, China). 5. Die Gliederung der Geschichte in Altertum, Mittelalter und Neuzeit ist zwar verhältnismäßig willkürlich, hat aber als klassisches Schema der Ordnung ihre Berechtigung. Der Schüler muß das Problem der Relativität jeder historischen Gliederung kennen, muß aber auch begreifen, daß sie für die Orientierung unersetzlich ist. Mit dem Beginn des Mittelalters, der Völkerwanderung, der Christianisierung Europas, der Ausformung der römischen Kirche und dem Wechselspiel zwischen Papst und Kaiser rückt für ihn die deutsche Geschichte in den Vordergrund. Er muß die wichtigsten Namen und Daten von Karl dem Großen bis zum Ende der Stauferzeit und die Ereignisse kennen, die zu ihnen gehören (Westrom, Ostrom, Islam, das Frankenreich, das Mönchstum, die Ottonen und Salier, Investiturstreit, Kreuzzüge, die Hohenstaufen, Ostkolonisation und Hanse). 6. Während der Etappe von 1273 (Wahl Rudolfs von Habsburg zum deutschen König ) bis 1356 (Goldene Bulle prägt sich die Grundstruktur des Heiligen Römischen Reiches aus (Landesfürstentum und monarchische Spitze), und in der Phase von 1414 (Konzil zu Konstanz) bis 1517 (Ablaßthesen Martin Luthers) erhält - im Zeichen von Humanismus und Renaissance - die Neuzeit ihre ersten Konturen. Der Schüler muß die Gründe für die einschneidenden Veränderungen kennen, die Rolle der Städte, des bürgerlichen Patriziertums, des Handels, ebenso die Verlagerung der Schwerpunkte durch die maritime Expansion und die Entdeckungen. Wie bei jedem anderen Abschnitt muß er sich ein grobes Raster von Namen und Zahlen einprägen. Der Unterricht hat dieses Datengerüst als festliegend zu betrachten und mit Hilfe höchstmöglicher Anschaulichkeit so etwas wie die „Gestalt" der Epoche entwickeln. Die Zeit von der Reformation bis zum Westfälischen Frieden 1648 muß trotz der zahlreichen Gegenströmungen und der unterschiedlichen Ausformung des Absolutismus in den deutschen Fürstentümern als Einheit begriffen werden. 7. Der Aufstieg Preußens zur Großmacht, der Dualismus Preußen - Habsburg im 18. Jahrhundert, das Phänomen der Aufklärung mit solchen Namen wie Thomasius, Kant, Lessing. Moses Mendelssohn muß dem Schüler genauso vertraut sein wie die Wirkungen der Französischen Revolution in Deutschland, die Stein-Hardenbergschen Reformen, die Befreiungskriege und die Bedeutung des Wiener Kongresses. Das 18. und 19. Jahrhundert besitzen für die deutsche Geschichte ein besonderes Schwergewicht. In dieser 8. Vom Wiener Kongreß 1815 bis zum Ersten Weltkrieg spannt sich das Jahrhundert der europäischen Nationalstaatsbildungen. Wenn ein Abiturient mit den Namen und Begriffen 9. Die Schüler jeder Altersstufe haben ein Recht auf Lehrbücher der Geschichte, deren Texte und Gestaltung nicht weitgehend ein dünner Aufguß akademischer Materialsammlungen sind, sondern die das geschichtliche Grundwissen anschaulich, farbig, einprägsam vermitteln. Auch Schulbücher sollte man mit Vergnügen lesen können anstatt mit Kummerfalten. Was steht eigentlich der Veröffentlichung einer Art „Kleinem Katechismus" des Basiswissens von der deutschen Geschichte im Weg, der in keiner Schule der Bundesrepublik fehl am Platze wäre: griffig, kurzweilig, aphoristisch? 10. Sobald der Schüler das Reifezeugnis erhält, muß er begriffen haben, daß er durch den Besitz eines Grundwissens von der deutschen Geschichte auch sein Selbstwertgefühl gefestigt und dem Zuschnitt seines Charakters Profil gegeben hat. Das klingt vielleicht prätentiös, aber für das T-Shirt der geistigen Beschränkung sollte sich jeder von uns zu gut sein.
Ein Heidegger im Olympiakader, Inbegriff der Renaissance, aber auch Inspiration für das heutige Lebensgefühl: Leon Battista Alberti, Kapitel „Logik der Leistung“ aus dem Buch „Geschichte macht Mut“, sowie erschienen in: Die Welt, Geistige Welt, 11.03.1989. Ein Heidegger im Olympiakader Als sich der Zeitgeist nur noch mit angstvollen Augen der Geschichte zuwandte, forderte der Historiker Hellmut Diwald „Mut zur Geschichte“. Nun, in Tagen allgemeiner Verzagtheit, behauptet Diwald: „Geschichte macht Mut“ – so der Titel seines jüngsten Buches, das demnächst im Straube Verlag, Erlangen, erscheint. Einen Beweis liefert ihm die Renaissance. Das entsprechende Kapitel drucken wir hier ab. Logik der Leistung Vor einem halben Jahrtausend bediente sich die Geschichte eines Zeitalters, um in einen Rausch der großartigsten und herrlichsten Kunstschöpfungen zu verfallen. Seit den Griechen hatte Europa nichts Vergleichbares aufzuweisen. Die Bahn, die das Faszinosum »Renaissance« zwei Jahrhunderte lang dahinzog, wird noch immer eingerahmt von Galerien staunender Betrachter. Man erkennt heute die Jahrzehnte der Frührenaissance als eine Zeit, in der die Bevölkerung Italiens mit einer unerklärlich plötzlichen Intensität den Sinn für das Schöne und die Schönheit entdeckte und ihn voll unerschöpflicher Lust auszuformen begann. Das betraf die Schönheit sowohl der Landschaft, als auch diejenige der Kirchen und Paläste, der Literatur und Dichtung, der Jahreszeiten und Stimmungen, und immer wieder und vor allem die Schönheit des menschlichen Körpers. Dazu besaß die Bevölkerung Italiens »Einsicht genug, um denen, die Schönheit schufen, Ehre, Aufmunterung und Unterstützung zu gewähren«. Die gewaltige Fülle der künstlerischen und schöpferischen Impulse der damaligen Zeit läßt sich als Ganzes kaum fassen. Es ist am ehesten zu begreifen in der Gestalt eines Mannes, dessen Ungewöhnlichkeit auf uns heute wie eine singuläre Erfindung jener Zeit wirkt. Der florentinische Künstler und Theoretiker Leone Battista Alberti wurde »als die verkörperte Synthese aller Strömungen seiner Zeit bezeichnet«. Um den Untergrund dieser Strömungen deutlich zu machen, hat sich der große Pädagoge der Frührenaissance, Vittorino da Feltre, eines Satzes Ciceros bedient: »Der Ruhm eines Mannes hängt von seiner Aktivität ab«. In der Renaissance hing freilich nicht nur der Ruhm davon ab, sondern die ganze Existenz. Mit der neuen Vita activa war aber keineswegs nur geistige oder künstlerische Aktivität gemeint, sondern genauso die politische, wirtschaftliche, militärische. Maßgebend für den Menschen war nicht, was er produzierte, sondern daß er produzierte. Gestaltende Aktivität wurde zu einer Grundbedingung des irdischen Daseins. Zwei Aspekte waren von besonderer Bedeutung. Erstens die Billigung jedes menschlichen Ausdrucks, gleichgültig ob er - nach der Einteilung der abgelebten Traditionen – körperlich oder geistig war. Zweitens die Erprobung sämtlicher Möglichkeiten, die in diesem völlig neuen Konzept des Menschen enthalten waren. Das Wesentliche des zuerst genannten Gesichtspunktes besteht darin, daß die körperliche Selbstbestätigung als Hochschätzung der Sinne und des Erotischen mit der Intention auf umfassende Glückserfahrung kein Theorem, Einheit der Schöpfung, Einheit des Körpers Ähnliches gilt vom zweiten Aspekt. Auch bei ihm wurde der Rückgriff auf die Antike durch den Zwang ausgelöst, eine gewandelte Persönlichkeitsvorstellung durchzusetzen, die nichts mehr mit der mittelalterlichen Vorstellung des Gläubigen zu tun hatte, und damit auch einem neuen Weltkonzept Geltung zu verschaffen. Von diesen Aspekten her ist die Konsequenz zu verstehen, mit der sich in der Renaissance darstellende Kunst zu selbstdarstellenden Kunst entwickelte und Weltrecherche als eine Form der Selbstrecherche auftrat. In der Frührenaissance wurde der intensivste Versuch der abendländischen Geschichte unternommen, die überlieferte Trennung zwischen Geist und Körper aufzuheben. Der Mensch wird als ein Mikrokosmos betrachtet und gilt als Entsprechung des Schöpfergottes und seiner Schöpfung. Deshalb ist das Human-Göttliche an ihm seine Fähigkeit, tätig zu sein. Um was es sich dabei handelt, ist zweitrangig. Darin liegt eine alles ergreifende Universalität, und eben sie hat sich so gut wie vollendet in Leone Battista Alberti verkörpert. Nur Alberti war es gegeben, festzustellen: »Sobald die Menschen wollen, können sie von sich aus alles. « Alberti war in jeder Hinsicht eine Ausnahmeerscheinung, auch in einer Zeit, die keinen Mangel an ungewöhnlichen Menschen zu beklagen hatte. Das Charakteristische war aber nun gerade der Umstand, daß das Exzeptionelle an ihm tatsächlich alles Zeittypische zum Ausdruck brachte und eben nur das Zeittypische. Als Leone Battista Alberti 1434 mit Cosimo de' Medici nach Florenz kam, war er dreißig Jahre alt. Er war überdurchschnittlich groß, aber körperlich von einer so kraftvollen Harmonie, daß Florenz ihm eine »furchterregende Vollkommenheit« attestierte. Heute würden wir ihn als einen Modellathleten bezeichnen. Es gab keine körperliche Übung, in der Alberti nicht Meister gewesen wäre. Er machte sich das Vergnügen, aus dem Stand mit zusammengebundenen Fußknöcheln über einen aufrecht stehenden Menschen hinwegzuspringen. Im Dom schleuderte er eine Münze bis ins Gewölbe der Kuppel, jedermann konnte den metallischen Klang der Berührung hören, und nicht nur die Jugend von Florenz blieb der Mund vor Staunen offen stehen, wenn Alberti einen Apfel über die Domkuppel warf. Alberti konnte wilde Pferde zureiten wie kein anderer, seine artistischen Kunststücke auf Pferderücken hätten jeden Kosaken hingerissen. Größtes Vergnügen bereitete ihm das Bergsteigen auf Routen, die besonders schwierig waren. Die Streuung seiner Aktivitäten und Interessen ließ fast keinen Bereich unberührt, sieht man von der unmittelbaren Politik ab - mit der Einschränkung allerdings, daß sein Werk Della Famiglia bei den vornehmen Familien von Florenz ein ständig benutztes Handbuch wurde. Alberti verknüpft darin die altrömischen Tugenden mit den florentinischen Konventionen und stellt es als ein Prinzip auf, daß sich jeder einzelne Mensch der Stadtgemeinschaft von Florenz verpflichtet fühlen müsse. Nach dem Urteil eines amerikanischen Kulturhistorikers war er »ein guter Sänger, ein ausgezeichneter Organist, ein begabter Redner und amüsanter Plauderer; er besaß Verstand, Besonnenheit, Bildung, Lebensart und war freundlich gegen jedermann. Um Geldfragen kümmerte er sich kaum, die Verwaltung seines Besitzes überließ er seinen Freunden und teilte mit ihnen seine Einkünfte. Wie Leonardo ein halbes Jahrhundert später, so war Alberti ein Meister oder zumindest ein erfahrener Praktiker auf den verschiedensten Gebieten, in der Mathematik, Mechanik, Architektur, Skulptur, Malerei, Musik, Verskunst, Philosophie, im Drama und weltlichen und kanonischen Recht. Er veröffentlichte Schriften über alle diese Gebiete, darunter eine Abhandlung über die Malerei, welche auf Piero della Francesca und vielleicht auch auf Leonardo ihren Einfluß nicht verfehlte. Außerdem verfaßte er zwei Dialoge über die Frauen und die Liebeskunst und einen berühmten Versuch Vom Hauswesen (Trattato del governo della famiglia). Er war einer der ersten, der die Möglichkeiten der camera obscura erkannten. Seine Hauptbeschäftigung war die Architektur, und er reiste von Stadt zu Stadt, um Fassaden oder Kapellen im römischen Stil zu erbauen. « Schönheit ist Vollkommenheit Alberti, der »Wahrhaft Allseitige«, wie ihn Jacob Burckhardt nannte, wird stereotyp als die Inkarnation des Uomo universale der Renaissance beschrieben, er stellt geradezu die Hypostase eines Menschen dar, wie ihn die Zeit als Vorbild sehen wollte. Das wirklich Besondere Albertis wird jedoch erst deutlich, wenn man an die beiden anderen großen Gestalten der Renaissance und des Humanismus erinnert, an Leonardo da Vinci und an Erasmus von Rotterdam. Erasmus war der reine Heros des Hirns, körperlich hingegen eine Stubenexistenz, die der physischen Schlaffheit des späteren Gelehrtentums entgegenkam. Überdies hatte sich Erasmus ausschließlich konzentriert auf den literarischen Bereich der Studien. Leonardo dagegen teilte mit Alberti den ungeheuren Interessenkreis und das geniale Schöpfertum, doch getrennt waren beide durch die entscheidende Tatsache, daß Alberti keinen großen Unterschied machte zwischen der künstlerischen Arbeit, der Dichtung und dem Philosophieren, und einem intensiven Körpertraining. Alberti gehörte zu den wenigen, die griechisches Dasein nicht auf Philosophie oder Plastik reduzierten, sondern es wörtlich nahmen, so wie es Platon, Aristotelses, die Philosophenschulen verstanden hatten und wie es in Sparta gehalten wurde. Auf den Nenner des Neuhumanismus gebracht, den Goethe 1787 seine Iphigenie aussprechen ließ: »Das Land der Griechen mit der Seele suchend«, konnte die Antike auch nur allenfalls mit der Seele gefunden werden, nie aber in der Pracht ihrer humanen Gestalt, der körperlichen Formung und Schulung, wie sie Tag für Tag im »Gymnasien« stattfand, im Freien, unbekleidet - wie es das griechische Wort gymnos, nackt, ausdrückt. Das gesamte Philosophieren Platons spielt sich im Bezirk des Gymnasions ab. Platon selbst war stolz darauf, daß er bei den Isthmischen Spielen den Ringkampf gewonnen hatte. Überträgt man dies in unsere Zeit, hätte man sich Martin Heidegger als Mitglied unseres Olympia-Kaders vorstellen müssen. Für Alberti war es selbstverständlich, zwischen der produktiven Schöpfung, sei es Dichtung, Musik, bildende Kunst, und der eigenen Körperverfassung keine Trennung zuzulassen. Erst durch den literarischen Humanismus und einer Fülle anderer Entwicklungstendenzen, zumal der christlichen und bürgerlichen, wurde seit dem Beginn des neunzehnten Jahrhunderts in die großen Epochen der Geschichte und ihre Manifestationen des Schöpferischen eine Spaltung hineingetragen, das rein Geistig-Intellektuelle abgefiltert und das Schöne zu einem Produkt der optischen Wahrnehmung isoliert, unter Verzicht auf die somatische Selbstgestaltung. Die Griechen und Alberti wußten, daß Geist, Denken und Wissen nicht im Kopf lokalisiert sind, sondern - wenn wir uns schon an die sich seit Jahrhunderten eingebürgerten Trennungen halten - ebenso im Körper des Menschen, in allen seinen Sinnen, in seinen Gliedern, in den Muskeln und ihrem Tonus. Wo wäre bei einer solchen Sicht die Trennung zwischen Schönheit und sinnlicher Schönheit zu ziehen? Alberti empfand sich konzessionslos der Wirklichkeit verhaftet und in sie eingebunden, und das hieß in der damaligen Zeit: der Natur, der Natürlichkeit. Dort allein war die Norm zu finden. So formulierte Alberti, der unübertroffene Theoretiker der Frührenaissance, ein Prinzip, das den Künstlern zur Richtschnur wurde und bis hin zu Auguste Rodin als Credo galt: »Zuerst zeichne man den Menschen nackt, und dann umgebe man ihn mit dem Gewand. « Seine Definition der harmonischen Schönheit wurde berühmt: »Schönheit ist eine bestimmte gesetzmäßige Übereinstimmung aller Teile, die darin besteht, daß man weder etwas hinzufügen noch wegnehmen oder verändern könnte, ohne sie weniger gefällig zu machen.« In seinem Traktat Della pittura, diesem ersten Werk, das jemals über die Kunst der Malerei geschrieben wurde, erklärt Alberti das Studium des Körpers als die absolute Grundlage der Malerei, ja er betont bereits, wie wichtig die Kenntnis des Verhältnisses der einzelnen Muskelpartien zu den anderen ist: »Beim Malen des Aktes beginne man mit den Knochen, füge alsdann die Muskeln hinzu und bedecke den Körper mit Fleisch in einer Form, daß die Lage der Muskeln sichtbar bleibt. Es ließe sich einwenden, daß ein Maler nichts darstellen sollte, was er nicht sehen kann, doch diese Arbeitsweise entspricht dem Zeichnen eines Aktes, den man dann mit Faltenwürfen umgibt. « Dieses »Nicht sehen können« markiert bei Alberti nichts anderes als den Unterschied zwischen Natur und Vollkommenheit. Der künstlerische Realismus war nie auf Nachahmung oder Wiederholung ausgerichtet, sondern immer auf Vollkommenheit. Also ideale Schönheit - was immer als ideale Schönheit in den verschiedenen Epochen der Geschichte gelten mochte. Die Parole dafür hatte schon Aristoteles ausgegeben, in einer seiner unvergleichlich dürren und ebenso genauen Festsetzungen: »Die Kunst vervollständigt das, was die Natur nicht zu Ende bringen kann. Der Künstler vermittelt uns die Kenntnis von den unverwirklichten Zielen der Natur. « Die unverwirklichten Ziele: Muß man Künstler sein, um diesen Satz zu begreifen? Enthält er nicht einen Imperativ, der eine der glanzvollsten Anweisungen und Lehren der Geschichte darstellt, die es überhaupt gibt? Richtet er sich nicht an alles, was wir Menschen hervorbringen als Zeugnis von uns und Bestätigung unserer selbst? Den Hintergrund bildet eine gewaltige Aufforderung: Achte auf deine Gedanken, bilde dich, schule dich, lerne, nimm dir etwas vor, realisiere deine Wünsche, Erwartungen, Träume, achte auf dich selbst, deine Hände, deine Haut, deine Muskeln, deine Beweglichkeit, deine Proportionen, mißachte nicht die Gegebenheiten des Körpers. Reflektiere nicht nur intellektuell, sondern reflektiere deinen Körper, beim Spielen, Laufen, Kämpfen, Ringen, bei der Anstrengung bis zur Erschöpfung. Einsicht und Lernmotivation Erziehung gehört zu den ursprünglichsten Phänomenen des Lebens. Ob es sich um die Fähigkeit zu sozialem Verhalten, um Anpassung an fremde Landessitten und alte Volksbräuche, um die Schulpflicht oder um Verkehrsregeln handelt: Erziehung ist immer im Spiel. Schwierig wird es dort, wo die Einwirkung des Erziehens nicht mehr unmittelbar stattfindet wie beim jungen, unmündigen Menschen: mit Beginn der Volljährigkeit. Der Staat nötigt zwar auch den Erwachsenen zu einem bestimmten Verhalten, aber Steuerpflicht, Straßenverkehrsordnung oder gesetzliche Regelungen betreffen kaum den intimen Persönlichkeitsbereich. Obgleich das einzige direkt benannte pädagogische Ziel den »mündigen Bürger« vorstellt, gibt es keine verläßliche Auskunft der Experten, was die Mündigkeit eigentlich sei. Ob ein mündiger Mensch wirklich in der Lage ist, Selbstbestimmung zu vollziehen, wird noch lange strittig bleiben. Unsere Gesellschaft setzt aber ohne Wenn und Aber diese Fähigkeit voraus. Kein Verkehrsrichter würde einen Verstoß gegen die geltenden Regeln nachsichtiger ahnden, falls sich der Schuldige auf Mängel in seiner Erziehung zur Mündigkeit berufen sollte. Im Gegenteil, er würde eher den Entzug des Führerscheins wegen freiwillig eingestandener Fahruntüchtigkeit riskieren. Zur Erziehung gehört der Erzieher. Das berührt die düsteren Nischen des Themas. Selbst wenn wir in der uns vertrauten Kultur schon lange nichts mehr mit der Gleichsetzung von Schule, Paukschule und Haselstock zu tun haben und nur noch selten Autoritäten entdecken, die ex cathedra lehren, ist nicht zu verkennen, daß zur Erziehung ein Moment der Nötigung gehört. Es steckt in den Wendungen von Disziplin und Selbstdisziplin. Nötigung erleben wir von klein auf als ein Gewaltverhältnis, zu ihr gehören zahllose Elemente der Dressur. Selbst in der liebevollsten Überredung tarnt sich Zwang. Der Appell an die Einsicht als Eckstein der Lernmotivation hat die meisten Erwartungen bitterlich enttäuscht. Er setzt eine Fähigkeit voraus, die nur im Lauf der Erziehung, mit ihrer Hilfe oder auch ihr zum Trotz, erreicht werden kann. Ob die letzten Jahrzehnte der unablässigen Schulreformen und -experimente unseren heutigen Schülern ihre Jugend nicht als eine Historia dolorosa erscheinen lassen, wie es bei den Großeltern der Fall war, das werden wir im nächsten Jahrzehnt erfahren. Die Aussichten versprechen wenige Überraschungen. Die massivsten Klagen und Vorwürfe bei uns kreisen seit langem um den Begriff der Leistung. Auch wenn die Jahre seiner radikalen Abwertung vorbei sind, wird der tatsächliche Wert der Leistung vor dem Hintergrund der Berufsnot und Arbeitslosigkeit verfälscht. Leistungsfähigkeit ist darauf angewiesen, daß sie unter Beweis gestellt wird. Die Wirtschaftslage mit ihrem scharfen Wind macht es schwer, in der Leistung ausschließlich das Konstruktive, Wünschenswerte, ja Bewunderungswürdige zu sehen. Sie gibt auch denjenigen zusätzliche Handhaben, die dem Leistungsbegriff politisch Verwerfliches unterschieben: »Das Leistungsprinzip funktioniert im kapitalistischen System in allererster Linie im Interesse des Kapitals und der herrschenden Klasse; die Leistungsideologie dient dabei wesentlich der Disziplinierung der Lohnabhängigen. « Das Glück der Leistung Zu solchen Deutungen steht die Einzelleistung als eines der wichtigsten Momente der Personalisierung in einem schroffen Gegensatz. Leistung aus der Sache verbindet sich mit außerordentlicher Faszination. Sie hat etwas enorm Beflügelndes, Befreiendes. Warum wird davon so wenig gesprochen? Welcher Lehrer würde nicht diejenigen Augenblicke zu den schönsten seines Berufes zählen, in denen er nach einer guten Leistung die Quittung dafür in den vor Stolz strahlenden Augen des Schülers ablesen kann. Welcher Feinmechaniker erinnert sich nicht voll Selbstbewußtsein an sein Gesellenstück? Solche Erfahrungen gehören zu einer guten Note genauso wie zu dem mit Qualen und Schmerzen mühsam errungenen Sportabzeichen und zu jeder anderen beliebigen, mit Einsatz, Entsagung, höchster Anspannung, Disziplinierung, ja auch durch rüdeste Schinderei freiwillig erbrachten Leistung. Ob sich in derartigen Kasteiungen ein enthumanisierter Masochismus verbirgt? Das sind Schreibtischfragen. Es gibt keinen ernst zu nehmenden Einwand gegen die Bereitschaft, auf etwas zu verzichten, um dafür etwas zu gewinnen: um mit Hilfe gewisser Unlust, die keineswegs nur als sinnlose Zumutung empfunden werden muß, aber trotzdem Unlust bleibt, gesteigerte Lust zu erreichen. Warum soll jemand, dem es Vergnügen macht, nicht bis zum Umfallen trainieren, wenn er die 100 Meter statt in 11,3 in 11,2 Sekunden laufen oder wenn er statt 70 Kilo zwei Scheiben mehr stemmen will? Abgesehen davon, daß sportliche Ziele ohne harten Einsatz nicht zu erreichen sind, ergeben sich bei körperlicher Leistung auch noch einige Effekte, von denen nur selten gesprochen wird. Kaum jemals läßt sich so unmittelbar Selbstbestätigung erleben wie durch eine extreme physische Anstrengung, die durch Mobilisierung aller Willenskräfte, des ganzen Charakters, sämtlicher Fähigkeiten zur Selbstdisziplinierung entstanden sind. Dabei verschiebt sich häufig im Widerspiel zwischen dem Interesse, das zur Leistungsmotivation wurde, und dem freigefaßten Entschluß der Akzent von der ursprünglichen Intention zum Leistungsaufwand. Er bekommt dadurch ein eigenes Gewicht, ja kann zum Selbstzweck werden mit dem Effekt, über sich selbst hinausgehoben zu werden. Hier setzen Erfahrungen ein, die der Öffentlichkeit kaum bekannt sind, obwohl sie von Millionen erlebt wurden und obwohl sie jedem offenstehen. In kleiner Münze, und ohne daß man sofort weiß warum, drückt sich das im Äußeren derjenigen aus, die sich konzentriert körperlich betätigen: Sie sehen gut aus, sie »machen eine gute Figur«, sie sind schöner. Wenn Goethe diese Menschen sehen könnte, hätte er noch einen zusätzlichen Grund zu seiner Klage, als er vor der hadrianischen Kopie des Apoll vom Belvedere stand: »Warum zeigst du dich in deiner Nacktheit, daß wir uns der unsrigen schämen müssen? « Eine überdurchschnittliche körperliche Leistung, gleichgültig um welchen Sport es sich handelt, faßt sämtliche Kräfte ohne Ausnahme zusammen. Die extreme Anspannung bedingt eine maximale, wenn nicht vollständige Abwendung von allem Äußeren. Einsatz sämtlicher Kräfte bedeutet deshalb eine uneingeschränkte Vorherrschaft unserer inneren Kapazitäten. Die extreme Körperleistung geht über in körperliche Entäußerung. Viele Hochleistungssportler berichten, daß sie in einem Trancezustand gewesen seien. Fast regelmäßig stellen sich auch bei normal hartem Training rauschhafte Erlebnisse ein. Die Berichte zeigen übereinstimmend, daß hier tiefste Bereiche des eigenen Zentrums erreicht werden. Das Erlebnis, »mit sich selbst völlig in Einklang zu sein«, ist in seiner Intensität nur vergleichbar mit den altbekannten Zuständen der Ekstase oder Meditationsphänomenen; von der Substanz her besteht tatsächlich eine enge Verwandtschaft. Wer in diesen Gebieten einmal fündig geworden ist, beginnt seine Bewertungskategorien zu überprüfen. Aktionsfreude als eine der höheren Formen der konstruktiven Grundhaltung erscheint dann in einem solchen Grad als unersetzlich für die Selbstvergewisserung, wie es früher bei aller Phantasie nicht vorstellbar gewesen wäre, - von der aber Leona Battista Alberti so viel wußte. Der Wille zur Leistung wird zur Konsequenz einer selbstverständlichen Logik. Das läßt sich allerdings nicht durch Imagination nachvollziehen, und schon gar nicht von den Zuschauertribünen oder aus der Ecke der misanthropischen Kritiker, sondern ausschließlich praktisch, also durch körperlichen Einsatz, durch Intensität des Geistes, durch Konzentration jeder Art. Deshalb heißt es auch in einer der effizientesten Sportarten, kurz und klar, mit lapidarem Spott: »Eisen macht stark. Man muß es nur anfassen. « Nicht auf das Eisen kommt es an, sondern auf das Anfassen, den Zugriff, die direkte Teilhabe, das Engagement, die Identifizierung: mit sich selbst, mit der Sache, mit dem anderen, mit dem Sosein, mit der Herkunft, mit der Geschichte. Daß körperliche Leistung, daß Engagement schön macht, wurde nicht beiläufig festgestellt. Der Begriff des Schönen bildet seit jeher eine sittliche Kategorie. Schönheit leuchtet im Sport auf, Schönheit leuchtet in jeder selbstvergessenen Tätigkeit auf, in allem, was uns von uns selbst abzieht und uns dadurch wieder näher zu uns bringt. Ludwig Wittgenstein, der bündigste Denker unseres Jahrhunderts, brachte das in fünf Worte: »Ethik und Ästhetik sind eins. « Nichts bestärkt darin mehr als die Geschichte. Sichtbar wird es bei weitem nicht nur in so herausragenden Persönlichkeiten wie in Alberti. Es wird sichtbar in den großen Denkentwürfen, in den großartigen Bauwerken der Städte, in der Energie einer Herrscherin wie Maria Theresia, in den Köstlichkeiten auch solcher Ereignisse, die zwar nur abgeschwächt geschichtswirksam waren, in denen aber die Menschlichkeit selbst weit eher zu finden ist als in den angestaunten Heroen. Wer das bedenkt, wird beinahe selbstverständlich dasjenige von der Geschichte festhalten, was den Entschluß stärkt, die Vita activa zu praktizieren. Und wer das zu akzeptieren vermag, wird sich so verhalten können, wie es ein französischer Historiker von einem Großen der Geschichte sagte - sicherlich ohne daran zu denken, daß vielleicht die schöne, unglückliche Kassandra kaum etwas dagegen einzuwenden gehabt hätte: »II etait plein d'esperance mais sans aucune Illusion«, - voller Hoffnung also und ohne jede Illusion: Das gibt dem Mut das Recht, ein Abbild unserer selbst zu spiegeln, in dem wir uns wiedererkennen.
Wahrheiten, in: Die Welt, Nr. 270, 18.11.1989. Wahrheiten Er hat die moderne Geschichtswissenschaft aus der Taufe gehoben - Leopold von Ranke. Und er war versessen auf Genauigkeit. Deswegen formulierte er Grundsätze, die bis heute viele Historiker ärgern. Sein Motto war simpel: „... bloß zeigen, wie es eigentlich gewesen". Die Geschichte allein sollte sprechen: „Ich wünschte mein Selbst gleichsam auszulöschen und nur die Dinge reden, die mächtigen Kräfte erscheinen lassen." Solche Prinzipien erregten die Kollegen um so stärker, je schwächer es mit dem eigenen Selbst bestellt war. Das Gezeter findet sich in vielen Büchern: Welch absurde Forderung, sein „Selbst" auslöschen zu wollen! Wer das versuche, sei doch unfähig, etwas zu erkennen. Als hätte das Ranke nicht gewußt. Und als wäre nicht zu verstehen, was er meinte. Trotzdem muß man bis heute immer wieder klären, was er unter „Objektivität" versteht, nämlich: „Nackte Wahrheit ohne allen Schmuck; gründliche Erforschung des einzelnen; das übrige Gott befohlen, nur kein Erdichten, auch nicht im Kleinsten, nur kein Hirngespinst." Wir Deutschen ächzen nach wie vor unter der Tonnenlast der Geschichte dieses Jahrhunderts. Ständig mahnen uns Staatsrepräsentanten jeglicher Couleur an die teuflische Dreiheit unserer angeblichen Schuld: Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Drittes Reich. Vor diesem Menetekel duckt sich alle geschichtswissenschaftliche Kompetenz. Ranke hatte behauptet, das Ziel der objektiven Darstellung von Geschichte sei „die Vergegenwärtigung der vollen Wahrheit". Doch zur Zeit geht diese Wahrheit in die Knie vor dem Diktat parteipolitischer Moralität. Für uns Deutsche scheint Objektivität ein verbotenes Getränk zu sein. Zum Beispiel Reichstagsbrand: Da schrieb vor einiger Zeit ein Fachmann nach vielen Jahren Forschens ein dickes Buch. Er bewies, daß weder Göring noch die SA im Februar 1933 den Reichstag angezündet hätten. Ein höchst objektives Buch. Daraufhin stöhnte ein anderer Historiker, der sich in der Geschichtsschreibung im Dienst der Sachlichkeit weniger wohl fühlt als in der zeitgeistgemäßen Erziehung unverbesserlicher Deutscher: Die Beweise in Sachen Reichstagsbrand seien zwar schlüssig, aber aus volkspädagogischen Gründen wäre jenes Buch besser nicht geschrieben worden. Da haben wir's. Wie meinte Ranke? „Nur kein Hirngespinst!" Doch was tun. wenn das Hirngespinst im Dienst der Volkserziehung politisch zweckmäßigere Ergebnisse zeitigt als die Objektivität? Soll die Geschichtsforschung unter das Damoklesschwert des Wünschenswerten gestellt werden? Vor 2000 Jahren hatte Polybios gemeint: „Die Wahrheit ist das Auge der Geschichte.“ Viel Ahnung scheint der Mann nicht gehabt zu haben. Er war ja nur einer der größten Historiker der Antike. Der Umbruch am Ende des Jahrhunderts, in: Handelsblatt, Signatur der Zeit Nr. 158, Düsseldorf, 17./18.08.1990. Dieser im Handelsblatt erschienene Beitrag ist das leichtgekürzte Schlußkapitel aus dem sechsbändigen Werk „DIE GROSSEN EREIGNISSE“ Der Umbruch am Ende des Jahrhunderts Die überschaubare Geschichte des Menschen wird häufig mit der Zeitspanne verglichen, die seit dem mutmaßlichen Entstehen der Erde vergangen ist. Daran gemessen wirkt die Historie des Menschen als belanglos. Schätzt man den Zeitraum der Erdgeschichte auf vier Milliarden Jahre, so entstand das höchstentwickelte Lebewesen, die Vorform des Menschen, vor vier Millionen Jahren — eine Zeitspanne, die tausendmal kürzer ist als die Erdgeschichte. Der denkende Mensch, der Homo sapiens, trat erst vor zwanzigtausend Jahren auf. Den Beginn jener Geschichte schließlich, die sich in Dokumenten niederschlägt, verbinden wir mit Ereignissen, die nur fünftausend Jahre zurückliegen. All die ungezählten Herrscher, Königreiche, Schlachten, Triumphe der Erkenntnis und Tragödien der Hoffnungen: Sie fanden innerhalb eines absurd winzigen Zeitraums der Erdgeschichte statt. Wer religiös gestimmt ist, könnte angesichts der unwahrscheinlichen Abgründe, die sich mit diesem Panorama vor ihm auftun, fragen: Was sind die Zeiten und ihr Wechsel vor dem Thron des Herrn? Epochenumbrüche haben mit Stimmungen, mit Pessimismus oder Zuversicht nur wenig zu tun. Mit den modernen Wissenschaften und der angewandten Forschung, mit der Technik und ihren Auswirkungen auf die Daseinsgestaltung wurde schon im neunzehnten Jahrhundert die folgenschwerste Zäsur der Weltgeschichte verbunden. Was diese Zäsur aber tatsächlich bedeutet, das wird uns erst jetzt, am Ende des zweiten Jahrtausends, vor Augen geführt. Das naturwissenschaftliche Denken, das im Zeitalter der Renaissance entstand, war bedingungslos auf die Sachen gerichtet. Gleichlaufend mit den Naturwissenschaften entstanden die neuzeitlichen Geisteswissenschaften. Unter ihnen gewann die Geschichtsforschung ihr besonderes Gewicht durch die Entschiedenheit, mit der sie ihr Erkenntnisstreben nicht auf die Sachen, sondern auf den Menschen und seine Manifestationen richtete. Sie trug damit nicht nur maßgeblich zum Wissen über uns selbst bei, sondern sie entwickelte dadurch in einem Höchstmaß die Fähigkeit zur Selbstreflexion: eines der hervorstechendsten Merkmale des heutigen Menschen Selbstreflexion bedeutet sowohl Selbsterkenntnis als auch Selbstkritik. Dies unterscheidet heutige Wissenschaft markant von allen Erkenntnisweisen der früheren Jahrhunderte. Spätestens seit den Lageberichten des Club of Rome in den siebziger Jahren und den hitzigen Diskussionen über das Für und Wider der Gentechnologie gibt es bei keinem Einsichtigen auf dem Erdball ernsthafte Zweifel daran, daß sich in der letzten Phase unseres Jahrhunderts mit der Entwicklung der Wissenschaften und der praktischen Anwendung ihrer Erkenntnisse buchstäblich endzeitliche Risiken verbinden. Solche Perspektiven wecken noch ein ganz anderes Entsetzen als das der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki 1945. Damals hatte der Mensch zum erstenmal in der Weltgeschichte ein Werkzeug entwickelt, mit dem er von heute auf morgen den Erdball und sich selbst vernichten konnte. Dieser Erkenntnis wurde aber bald die Waage gehalten durch die Überzeugung, daß sich die Untergangsdrohung durch die Entschlossenheit der politisch Verantwortlichen und Regierenden neutralisieren lasse. Die Möglichkeiten reichten von der Fiktion des „Gleichgewichts des Schreckens“ über das „rote Telefon“, der direkten Telefonleitung zwischen dem Weißen Haus und dem Kreml, bis zu dem Entschluß, die Nuklearwaffen energisch und ohne Rücksicht auf machtstaatliche Überheblichkeiten abzurüsten. Sowohl die Sowjetunion als auch die Vereinigten Staaten mußten die Produktion von Atomsprengköpfen erst ins Unübersehbare steigern, um zu begreifen, daß die Sorge, das Gesicht zu verlieren, überflüssig wird, sobald man den Kopf verloren hat. In den fünfziger Jahren wurde das Grauen eines möglichen Atomkrieges auch weitgehend durch die Hoffnungen ausgeglichen, die sich auf die zivile Nutzung der Kernenergie richteten. Sie bestehen noch immer, wenn auch beträchtlich gemindert durch die Fülle der Probleme, die vor allem zu der Endlagerung der hochradioaktiven Spalt- und Abfallprodukte gehören. Die Befürworter der Kernenergie müssen sich heute auf einem Feld behaupten, das nicht nur eindrucksvoll von Gegnern des Atomstroms besetzt ist, deren Abwehr weitgehend auf Gefühl und Instinkt beruht, sondern auch von Wissenschaftlern, die sich auf gewichtige Sachgründe stützen. Niemand kann bestreiten, daß die Risiken beim Umgang mit radioaktivem Material extrem hoch sind. Sie zwingen zu Kontrollsystemen, deren Umfang sich kaum noch ausweiten läßt ohne prinzipielle Eingriffe in das soziale Umfeld. Sie wären tief genug, um die individuelle und die politische Freiheit des Menschen und seiner Gesellschaft in Frage zu stellen. Das Schlüssel- und Reizwort dafür heißt „Atomstaat“. Ihren ersten Höhepunkt erreichte die Diskussion über die Gefahren der Kernenergie am 28. März 1979. An diesem Tag ereignete sich im amerikanischen Kernkraftwerk Three Miles Island bei Harrisburg ein Reaktorunfall — der erste Gau, der größte anzunehmende Unfall, wie die denkbar schwerste Störung in einem Kernkraftwerk bezeichnet wird. In Harrisburg gelang es nach sechzehn Stunden, die ausgefallene Kühlwasserversorgung weitgehend wieder in Gang zu bringen; die Schäden blieben begrenzt. Zum zweiten, dem absoluten Höhepunkt, kommt es am 26. April 1986 im Block 4 des sowjetischen Kernkraftwerks Tschernobyl nördlich von Kiew. Während des Versuchs mit einem Sicherheitssystem zur Notkühlung, beginnen nach einer Reihe von Bedienungsfehlern, die Brennstäbe im Graphitblock des Druckröhrenreaktors zu glühen. Nach zwei dicht aufeinanderfolgenden Explosionen schießen radioaktive Gase und Spaltprodukte in die Atmosphäre. Die Aktivität, nach Becquerel gemessen, ist so immens, daß sie der Radioaktivität allen Tritiums oder Natururans entspricht, das sich in unseren Weltmeeren befindet. Die meisten Nuklide, etwa fünfundsiebzig Prozent, fallen im Umkreis von zwanzig Kilometern wieder zu Boden. Der Rest wird vom Wind nach Westen getragen. Er lagert sich in ganz Europa ab. Die freigesetzte Radioaktivität von Tschernobyl entsprach dem Fallout von etwa eintausend Hiroshima-Atombomben. Die Wolke aus der Ukraine zog um den Erdball. Die unmittelbaren Schäden der Tschernobyl-Katastrophe sind nachzuweisen. Sie sind fürchterlich. Mehr als einhunderttausend Menschen mußten sofort evakuiert werden. Im Umkreis von zweihundert Kilometern waren neun Millionen Menschen betroffen. Den Grad ihrer Gefährdung macht das Schicksal eines amerikanischen Filmteams deutlich, das 1954 im Bundesstaat Utah arbeitete, zweihundert Kilometer weit vom Testgebiet in Nevada entfernt, in dem im Jahr zuvor ein Atombombenversuch stattgefunden hatte. Der radioaktive Ausfall wurde vom Wind nach Utah getrieben. Sämtliche Mitglieder des Filmteams, an ihrer Spitze Susan Hayward und Amerikas Idol John Wayne, starben später an Krebs. Die Langzeitschäden durch Tschernobyl bei den Millionen Betroffenen in Europa sind freilich nicht unmittelbar nachzuweisen, selbst wenn in besonders verseuchten Gebieten nach Jahren eine steigende Zahl von Krebserkrankungen festzustellen wäre. Das gehört zur Heimtücke der radioaktiven Langzeitwirkung; sie öffnet auch der Verharmlosung, zumal der aus politisch-wirtschaftlichen Gründen betriebenen, Tür und Tor. Schlußfolgerungen direkter Art werden sich erst ziehen lassen, wenn der gesamte Ursachenkomplex der Karzinome erforscht ist. Radioaktivität erzeugt Krebs, doch bei jedem Menschen aufgrund unterschiedlicher Belastungen — abgesehen von anderen, uns noch weitgehend unbekannten Auslösern. Heute können wir lediglich feststellen, daß vor einem Vierteljahrhundert etwa jeder siebente Bundesbürger an Krebs starb. Nunmehr ist es fast schon jeder vierte. Das Trauma der Angst, das durch Tschernobyl entstand, schwelt bis heute weiter. Eine Einigung oder auch nur Annäherung der Kontrahenten bei der Einschätzung der Kernenergie ist nicht in Sicht. Die Befürworter weisen ständig darauf hin, daß die Belastungen durch Strahlen in der Natur zumeist weit höher sind als diejenigen der Radioaktivität, die durch Verseuchung oder vorübergehende Erhöhung dem Menschen zusetzen. Die Kritiker halten dagegen, daß jedes Becquerel, dem wir zusätzlich unterworfen sind, auch eine zusätzliche Gefährdung bedeutet. Gegen Bestrahlung, ob durch einen Störfall oder durch ununterbrochene kleine, angeblich „ungefährliche“ Abgaben, gebe es keinen Schutz. Im übrigen existiere kein Grenzwert, bis zu dem Radioaktivität „unschädlich“ sei. Auch die kleinste Menge könne Schäden bewirken. Tschernobyl sei demnach, wenn nicht aus der Kernenergie ausgestiegen werde, überall. Nicht zu bezweifeln sind folgende Fakten: Radioaktive Verseuchung hat genetische Veränderungen zur Folge. Das bedroht die neugeborenen Kinder. Kinder aber sind keine statistische Größe, sondern etwas ureigen Persönliches. Am gefährlichsten wirken diejenigen radioaktiven Stoffe, die wir über die Pflanzen des Bodens, das Wasser, durch die Luft aufnehmen und die in unseren Organismus gelangen und darin bleiben. Am brisantesten jedoch ist der Atommüll. Es handelt sich dabei um das dringendste aller Probleme der Kernenergie. Wer die greifbaren Vor- und Nachteile bei der traditionellen Energieerzeugung und der Kernenergie abwägt, wird sich für den Atomstrom entscheiden. Wiegt dieses Plus die ungeheuren Gefahren auf, die zur Langlebigkeit der radioaktiven Abfälle gehören? Transuranische Aktivitätsprodukte wie das Plutonium müssen Tausende bis Millionen von Jahren absolut isoliert und für immer von der Biosphäre ferngehalten werden. Zeiträume dieser Dimension sind nicht mehr geologischer, sondern theologischer Art. Die Fachleute, auch diejenigen, die Atomkraft befürworten, sehen bis heute keine Lösung. Solange dies der Fall ist, umreißen Erklärungen, daß dieser oder jener Vorschlag „unbedenklich“ sei, keine angemessene Technologie, sondern sind Beiträge einer „Endlagerungsphilosophie“. Die „Rand Corporation“, die größte politisch-militärische Forschungsgesellschaft der Erde im kalifornischen Santa Monica, meinte schon vor zwei Jahrzehnten: „Keine der vorgeschlagenen Lagermethoden erscheint zur Zeit zufriedenstellend. Das Problem muß gelöst werden, bevor die Anzahl der Kernkraftwerke stark erweitert werden kann.“ A 1s in den Vereinigten Staaten ein großangelegter Versuch der Endlagerung in Salzbergwerken zu einer alarmierenden Häufung von unerwarteten Schwierigkeiten führte, erklärte Senator Mike Gravel: „Es kann nur als ein Verbrechen gegen die Menschheit bezeichnet werden, wenn man absolut tödlichen Atommüll produziert, der für Hunderttausende von Jahren gefährlich bleibt, wenn bisher noch keiner weiß, wo wir ihn gefahrlos lagern können. Falls dies kein Verbrechen sein sollte, dann ist es wohl Wahnsinn. Gewiß ist es jedoch keine Unschuld, denn die Personen, die diese Politik betreiben und sie fördern, sind oft genug auf ihr Tun aufmerksam gemacht worden.“ Wer heute auf den Atomstrom setzt, müßte sich auf eine vollkommen sichere Methode der risikofreien Beseitigung des Atommülls stützen können. Solange dies fehlt, ist Atompolitik ethisch fragwürdig. Der Einwand, alle Technik sei mit Risiken verbunden, ist vordergründig. Bei der Endlagerung steht anderes an als eine Frage der Verhältnismäßigkeit entsprechend der Empfehlung, sich bei der Wahl zwischen zwei Übeln für das kleinere zu entscheiden und nicht, wie der Pessimist, für beide. Nichts ist in Sicht, das für eine baldige Lösung der Endlagerung spricht Kein Wissenschaftler kann zur Zeit etwas gegen die These vorbringen: Das Problem des Atommülls ist niemals zu lösen. Wer die Folgen durchdenkt, ist unfähig, die Leichtfertigkeit zu begreifen, mit der die Atomkraft befürwortet wird, ohne daß die Endlagerung der Abertausende von Tonnen des Atommülls gesichert ist. Was kümmern die Verantwortlichen die Nöte der späteren Generationen, die sie ihnen als schreckliche Hypothek hinterlassen? Sie werden die Flüche der Menschen, die Jahrzehnte nach uns leben, nicht hören. Die Frage, wie der gewaltige Globalbedarf an Energie zu decken ist, stellt sich damit schärfer denn je zuvor. Gegenüber der Tschernobyl-Katastrophe wenden die Befürworter des Atomstroms ein, daß die rigorosen Sicherheitsvorschriften, die sich inzwischen fast überall durchgesetzt, in Sowjetrußland jedoch gefehlt haben, den Gau in der Ukraine unmöglich gemacht hätten. Noch stärker ist ein anderes Argument Die üblichen Kohlekraftwerke geben nicht nur beträchtlich mehr Radioaktivität in die Luft ab als ein Kernkraftwerk, sondern die Verbrennung fossiler Stoffe ist an erster Stelle verantwortlich für den katastrophalen Anstieg des Gehalts an Kohlendioxid in der Atmosphäre. Vor rund zweihundert Jahren betrug der Meßwert 290 ppm. Inzwischen ist er auf 330 angestiegen. Seit der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts hat er sich um ein Viertel erhöht. Für das Jahr 2000 rechnet man mit einem Anstieg auf 379 ppm. Der Anstieg von Kohlendioxid und von Methan bewirkt eine beträchtliche Erwärmung des Klimas: den Treibhauseffekt. Seine Natur ist leicht zu erklären. Unsere Luft besteht zu mehr als neunundneunzig Prozent aus Stickstoff und Sauerstoff. Beide Gase lassen die Infrarotstrahlung der Erde ungehindert passieren. Im Gegensatz dazu halten Kohlendioxid und die anderen Spurengase, so gering ihre Mengen auch sein mögen, die irdische Strahlungswärme zurück. Sie wirken wie das Glas eines Treibhauses. Kernkraftwerke schneiden im Vergleich mit der Energie, die durch die Verbrennung fossiler Stoffe gewonnen wird, erheblich besser ab. Doch auch sie tragen zu dem von den Experten zunehmend erregter diskutierten Treibhauseffekt bei: durch die Abwärme über die Naßkühltürme oder bei Direktkühlung durch die Temperaturerhöhung des Flußwassers um zehn Grad. Die atomare Wärme wird höchsten zu vierzig Prozent in Strom umgewandelt, der Rest geht verloren. Auch lassen sich die Schäden durch die Verminderung des Sauerstoffgehalts der Flüsse oder die Beeinträchtigung der Vegetation in der Umgebung von Kernkraftwerken nicht als belanglos abtun. Die unmittelbaren Zusammenhänge zwischen der Erwärmung der Luft und der Ozeane und deren Auswirkungen auf die allgemeine Wetterlage sowie auf alles irdische Leben schlechthin liegen noch weitgehend im dunkeln. Wenn auch viele Meßwerte umstritten sind, so ist sich doch das Gros der Klimatologen aller Länder in den wesentlichen Fragen geradezu bedrückend einig. Besonders bitter ist die globale Verflechtung aller Probleme. Schon im Jahre 1978 war in der US-Zeitschrift „Scientific American“ zu lesen: „Es gibt wohl kaum einen Aspekt nationaler und internationaler Planungen, der von der Aussicht globaler Klimaveränderungen unberührt bleiben kann.“ Wer aber läßt sich davon rühren? Zu den besonders deprimierenden Beispielen gehört die Mißhandlung der Nordsee. Unter den Experten gibt es inzwischen keinerlei Diskussionen mehr darüber, daß ihre Schädigung durch chemische Abfälle den höchsten Grad der Gefährdung erreicht hat und jede weitere Belastung ab sofort vermieden werden muß, um sie zu retten. Bei der 3. Nordsee-Konferenz im Jahre 1990 in Den Haag stand Großbritannien mit seiner Weigerung, die Einleitung von Klärschlamm und die Verklappung von Schadstoffen baldmöglichst einzustellen, völlig isoliert den übrigen europäischen Staaten gegenüber. Wenn die Regierung eines hochindustrialisierten Landes derart uneinsichtig ist: mit welchem Recht kann sie dann gegen die Abholzung der tropischen Regenwälder protestieren? Am stärksten wird das Klima verändert durch die Emission von Kohlendioxid. Für die Schädigung und Zerstörung der Ozonschicht im unteren Teil der Stratosphäre sind die Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) hauptverantwortlich. So unzureichend die Meßdaten auch im einzelnen sein mögen, so zweifelsfrei steht es fest, daß sich die globale Temperatur seit Beginn unseres Jahrhunderts um einen halben Grad Celsius und in den mittleren und hohen Breiten um einen Grad erhöht hat; in den letzten Jahrzehnten beschleunigt sich die Erwärmung. So geringfügig ein halber Grad Celsius erscheint, so beträchtlich sind die Folgen. Sie lassen sich einfach zusammenfassen: Wenn die Luft, die Erde, die Meere von Jahr zu Jahr wärmer werden, verschieben sich die Klimazonen, Gletscher beginnen verstärkt zu schmelzen, der Spiegel der Meere steigt an. Überschwemmungen, Sturmfluten, Hitze- und Dürreperioden, Orkane, selbstverschuldete Erhöhung der lebensfeindlichen Ultraviolettstrahlung — das alles steht uns nicht nur ins Haus, sondern ist schon ein Stück Gegenwart. Wälder binden das Kohlendioxid, genauso wie es durch die Photosynthese aller grünen Pflanzen gebunden wird. Schon heute verlangen die Fachleute, daß die Abholzung der Wälder unverzüglich zu beenden, der Verbrauch fossiler Stoffe um die Hälfte zu drosseln ist und umgehend ein weltweites Programm der Wiederaufforstung durchgesetzt werden muß, wenn die Klimaveränderung abgebremst und eine Katastrophe innerhalb überschaubarer Fristen verhindert werden soll. Die Aussichten für die kommenden Jahrzehnte sind düster. Nach dem jetzigen Stand des Energieverbrauchs und der übrigen Faktoren, die für die fortgesetzte Erwärmung verantwortlich sind, wird sich die globale Temperatur bis zum Jahr 2030 um zwei bis drei Grad erhöhen. Auf diese Zahl haben sich kürzlich fünfzig Meteorologen auf einer internationalen Tagung geeinigt. Jeder zusätzliche Grad Celsius verschiebt die Klimazonen im Verlauf eines Jahrzehnts um hundert bis hundertfünfzig Kilometer nach Norden. Was läßt sich gegen den Klimaschock unternehmen? Kann der Treibhauseffekt aufgehalten oder mindestens vermindert werden? Die Industrieländer sind an der Emission von Kohlendioxid mit fünfundsiebzig Prozent beteiligt. Energiesparen ist zwar das Wort der Stunde, doch seine Grenzen werden vom Bedarf der Wirtschaft abgesteckt. Verbesserte Nutzung ist deshalb so dringlich wie nur denkbar. Immerhin gewinnt man heute aufgrund neuer Verfahren aus einer Tonne Steinkohle doppelt soviel Energie wie 1950. Ebenso dringlich ist das sofortige Ende des Raubbaus am Wald und die unverzügliche Wiederaufforstung, vor allem in den tropischen und subtropischen Ländern. Überschläglich stehen zur Zeit achteinhalb Millionen Quadratkilometer gerodeter Waldgebiete zur Neuanpflanzung zur Verfügung; weit über die Hälfte liegt davon brach. Die Aufforstung könnte sofort beginnen. Die Anreicherung der Atmosphäre mit Kohlendioxid würde dadurch entscheidend gebremst Immerhin gibt es internationale Übereinkünfte, die letzten Endes auch das Ergebnis des Drucks sind, der durch das weltweit geschärfte Umweltbewußtsein der Bevölkerung entstand. Durch die Wiener Konvention zum Schutz der Ozonschicht und das Protokoll von Montreal 1987 kam es zum entscheidenden Schritt auf dem Weg zum Verzicht auf FCKW-Produktion. Doch auch in diesem Punkt war es fast schon zu spät. Die früher bei jeder Spraydose gebräuchlichen Treibgase, die irrtümlich als umweltneutral galten, steigen überaus langsam in die Atmosphäre. Sie sind chemisch stabil, bleiben also erhalten. In der Ozonschicht werden sie durch die ultraviolette Strahlung zerstört, dabei entstehen Chloratome, die ihrerseits die Ozonschicht zerstören. Der Langzeiteffekt ist bedrohlich, da diese Substanzen rund hundert Jahre aktiv bleiben. Selbst wenn man ab sofort alle FCKW-Gase verbieten könnte, würde die Ozonschicht noch ein volles Jahrzehnt zerstört; erst danach nähme die Schädigung allmählich ab. Das Problem des globalen Klimas und der Zerstörung der Umwelt und damit der schleichenden Selbstvernichtung der Menschheit hat zwei Seiten. Die eine besteht in den Erkenntnissen der Wissenschaftler und ihren Empfehlungen. Die andere in der Uneinsichtigkeit oder der Unfähigkeit derjenigen, die die notwendigen politischen Maßnahmen durchsetzen könnten. Bloße Appelle an das Weltgewissen, an die ethische Verantwortlichkeit und dergleichen helfen nicht weiter. Die Möglichkeiten der Sonnenenergie sind bis heute nur zu einem Bruchteil erforscht. Bei angemessener Investition könnten die Ergebnisse einen Durchbruch bewirken. Die Fragezeichen, die zu den Modellen des ökologischen Gleichgewichts, der Klimaveränderung, der Energieerzeugung und des Energiebedarfs gehören, sind gewaltig. Kaum weniger groß sind die Fragezeichen, die sich mit den vorgeschlagenen Lösungen verbinden. Verbindliche Antworten sind nicht allein aufgrund der wissenschaftlichen Strittigkeit vieler Probleme unmöglich. Eine genauso große Rolle spielt ihre praktische Undurchführbarkeit. Sämtliche Umweltprobleme sind globaler Natur. Ihre Lösung würde deshalb das globale Zusammenspiel aller Nationen erfordern. Dies wiederum würde voraussetzen, daß ein internationales Gesamtwirtschafts- und Industriesystem vorhanden wäre. Doch daran ist nicht einmal bei exzessiver Phantasie zu denken. Die Kluft zwischen den Ländern mit hochentwickelter Industrie und den Ländern der Dritten Welt, den Entwicklungsländern, vertieft sich von Jahr zu Jahr. Heute muß festgestellt werden, daß drei Jahrzehnte der Entwicklungshilfe kaum etwas zur Entschärfung der wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Probleme beigetragen haben. Was ist heute von dem erklärten Ziel „der Förderung des wirtschaftlichen Fortschritts und der Wohlfahrt der Entwicklungsländer“ übriggeblieben? Es gibt keine übereinstimmenden Konzepte der Entwicklungspolitik bei denjenigen Ländern, die heute als führend und verantwortlich für die Weltwirtschaftsordnung gelten und für das Nord-Süd-Gefälle, das sich solange in den Schlagzeilen befand. Das rapide Wachstum der Bevölkerung in Asien, Afrika und Lateinamerika hält allenfalls einen Vergleich mit dem Wachstum ihrer Verschuldung aus — nur daß sich dieses Problem, so heillos es auch ist, vergleichsweise leichter lösen ließe als die Minderung der Geburtenrate. Bis in die achtziger Jahre stand die Entwicklungshilfe überdies im Zeichen des Ost-West-Konflikts mit all seinen machtpolitischen, strategischen und ideologischen Interessen. Obwohl zur Zeit von dem dazugehörigen Konkurrenzverhältnis kaum noch etwas übriggeblieben ist, haben sich die Probleme der Entwicklungsländer um kein Gran verbessert, sieht man von der puren Hoffnung auf Besserung ab. Entwicklungshilfe scheint sich mehr und mehr auf karitative Katastrophenhilfe zu reduzieren. Sollte sich diese Tendenz erhalten, muß mit dem völligen Zusammenbruch zahlreicher Länder gerechnet werden. Die Folgen lassen sich nicht ausdenken. Forderungen solcher Art, daß „bessere politische und weltwirtschaftliche Rahmenbedingungen vor allem im Bereich des Welthandels und des internationalen Währungssystems für die Entwicklungsländer“ zu schaffen seien, sind Forderungen des grünen Tisches. Sie bewirken nicht mehr als die inbrünstigen Gebete des Heiligen Vaters. Für die Entwicklungsländer stellen sich die Probleme ähnlich de bei den Problemen der Umwelt Einerseits drängt die Zeit über alle Maßen, andererseits sind strukturelle Veränderungsprozesse, so rapide sie möglicherweise auch ablaufen könnten, immer auf Jahre hin angelegt. Zum sozialen Wandel in den Ländern der Dritten Welt, der sich durchaus als Modernisierungsprozeß deuten läßt, gehört nicht nur die drastische Senkung der Analphabetenquote. Erst die Fähigkeit des Lesens, der minimalen Bildung, ermöglicht die Entwicklung politischen Bewußtseins und damit der Fähigkeit, Aufgaben, Funktion und Dringlichkeiten des Gemeinwesens abzuschätzen und sich in einer Weise zu engagieren, die nicht nur den privat-persönlichen Nöten gerecht wird. Am 11. März 1985 wurde in Moskau vom Politbüro der KPdSU mit nur einer Stimme Mehrheit der vierundfünfzigjährige Michail Sergejewitsch Gorbatschow zum Nachfolger des verstorbenen Generalsekretärs Konstantin U. Tschernenko gewählt. Seit Stalin hatte es keinen jüngeren Generalsekretär des Zentralkomitees der Partei gegeben. Das mochte anfangs nur als Indiz für einen Generationswechsel an der Spitze der KPdSU erscheinen. Gorbatschow, bis dahin allenfalls ein hochbegabter, durch sein Wissen, seine Intelligenz, seine Untadeligkeit und Souveränität auffallender Karrierist, entpuppte sich in kürzester Zeit nicht als Mann einer neuen, jungen Generation, sondern als Initiator einer neuen welthistorischen Epoche. Nach seinem Amtsantritt hielt er am 23. April 1985 sein erstes Referat auf dem Plenum des Zentralkomitees. Es ging dabei um die Einberufung des XXVII. Parteitages der KPdSU für den 26. Februar 1986. Gorbatschow unterstrich, wie es auch bei seinen Vorgängern üblich war, die großen Erfolge der Sowjetunion in sämtlichen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, des sozialen Fortschritts, der Wirtschaft, Technik und Wissenschaft. Nach dieser Pflichtübung verhieß er, daß der bevorstehende Parteitag „zweifellos zu einem Meilenstein in der Entwicklung des Landes“ werde. Wer geglaubt hatte, daß auch dies nur eine der allzu vertrauten Beteuerungen wäre, wurde hellhörig, als Gorbatschow versicherte, die vorbereitende Arbeit für den Parteitag werde sich vor allem mit „einer tiefgreifenden Analyse der entstandenen Situation, kühnen Lösungen und energischen Aktionen“ befassen. Der Generalsekretär gab den Delegierten auch umgehend einen Vorgeschmack von dem, was sie zu erwarten hatten. Der Hauptteil seines Referats enthielt die schärfste Kritik, die jemals ein führender Politiker der Sowjetunion an den Zuständen des Landes geübt hatte. Gorbatschow prangerte an: Feigheit vor persönlicher Verantwortung, Verschwendung, Disziplinlosigkeit, Vergeudung materieller Werte, unrationelle Wirtschaftsführung, Verknöcherung der Partei, Phrasendrescherei, Stagnation der Organisationsstrukturen, fehlende Verbindung zwischen Wissenschaft und Produktion, Rückständigkeit in sämtlichen Zweigen der Volkswirtschaft, der modernen Technologien, der Elektronik, Überwuchern der Bürokratie, mangelnde Qualität der meisten Erzeugnisse: „Qualität und nochmals Qualität heißt unsere heutige Losung.“ Kein Wort jedoch wiederholte Gorbatschow in dieser Rede häufiger und mit größerem Nachdruck als das Wort „Beschleunigung“. Auf diesen Begriff konzentrierte er den Tenor seiner Ausführungen: „Die Hauptfrage besteht heute darin, wie und wodurch das Land eine Beschleunigung der wirtschaftlichen Entwicklung erreichen kann.“ Hier sah er den Schwerpunkt aller Anstrengungen. Gorbatschow setzte in dieser Rede das erste Zeichen einer stürmischen Wende in der Sowjetunion. Später kam er wiederholt darauf zurück. Bei der Eröffnung des XXVII. Parteitages am 25. Februar 1986 stellte er fest: „Die vom April-Plenum 1985 formulierte .Zielsetzung auf die Beschleunigung der sozialökonomischen Entwicklung unserer Gesellschaft' war Ausdruck dafür, daß sich die Partei über die grundsätzlich neue Situation innerhalb des Landes und in der Welt und über ihre hohe Verantwortung für die Geschichte der Heimat völlig im klaren ist, war Beweis für ihren Willen und ihre Entschlossenheit, herangereifte Umgestaltungen in die Tat umzusetzen.“ Was hier nach bewußt berechneter Ineinssetzung mit der kommunistischen Partei klang, war erheblich mehr. Die fundamentalen Veränderungen der letzten Jahre in der Sowjetunion sind aufs engste mit der Persönlichkeit des Generalsekretärs verbunden. Andererseits hätte Gorbatschow keinerlei Erfolg gehabt, wenn ihm nicht die Zustimmung einer neuen Generation der Delegierten, die Zustimmung der weit überwiegenden Mehrheit des russischen Volkes sicher gewesen wäre. Zur inneren Vergreisung der sowjetischen Herrschaftsstruktur kam der Unwille von Millionen über ein System, das keinen Raum ließ für eigene Aktivität und freie Entfaltung von Initiativen. Gorbatschows Programm läßt sich in kürzester Form mit den beiden Worten Perestroika — Umgestaltung und Glasnost - Öffentlichkeit umreißen. Die Umgestaltung der gesamten Lebensbedingungen begann praktisch unmittelbar nach seinem Amtsantritt. Zu ihr muß allerdings auch Gorbatschows ständiges Drängen auf „Beschleunigung“ gerechnet werden, sein drittes Schlüsselwort. Dies wird zumeist unterschätzt. Der Erfolg von Gorbatschows Programm hängt vor allem davon ab, ob es gelingt, mit der traditionellen Behäbigkeit und Gleichgültigkeit, mit dem Schlendrian und der fast hoffnungslos scheinenden bürokratischen Verzettelung auf schnellstem Weg fertigzuwerden. Deshalb bezeichnete er in der Abschlußrede auf dem Parteitag des Jahres 1986 die „Idee der Beschleunigung“ als entscheidend für den Erfolg der Umgestaltung. Stellt man in Rechnung, was seit dem Herrschaftsantritt Stalins 1924 in der Sowjetunion alles eingefroren war, dann läßt sich die Bedeutung des Umbruchs in Rußland seit 1985 kaum ermessen. Gorbatschow berief sich zwar bei der Begründung seiner Maßnahmen immer wieder auf Wladimir Iljitsch Lenin — doch alles, was er in Gang setzte, war eine klare Absage an jenen Marxismus, der so viele Jahrzehnte für die Sowjetunion und das Ziel der Weltrevolution ein eisernes Programm dargestellt hatte. In seinem langen Grundsatzreferat über die „Umgestaltung der Wirtschaftsführung“ vor dem ZK-Plenum am 25. Juni 1987 begründete Gorbatschow sogar die Behauptung, daß „Demokratisierung die entscheidende Voraussetzung für die Perestroika“ sei, mit einem wörtlichen Zitat aus Lenins Werken. Die Umgestaltung in der Sowjetunion, die sich unter dem Mantel des bis jetzt offiziell unangetasteten Sozialismus Leninscher Prägung als eine Reform des Kommunismus ausgibt, stellt eine komplette Bankrotterklärung des Sowjetsystems dar — sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich und ideologisch. Im ökonomischen Bereich läuft Gorbatschows Umgestaltung auf die simple Devise hinaus: gestern Mißwirtschaft, heute Marktwirtschaft. Statt der zentralen Reglementierung durch einen Arbeitsplan wird auf die Mobilisierung aller Eigenkräfte, wird auf das Prinzip der persönlichen Leistung samt dem entsprechenden Lohn gesetzt. Was sich in den vergleichbaren Ländern als Soziale Marktwirtschaft aufgrund seiner Ergebnisse als Nonplusultra leistungsfähigen Wirtschaftens durchgesetzt hat, liest sich in der Version Michail Gorbatschows folgendermaßen: „Wir müssen im Einklang mit dem Prinzip des Sozialismus leben und handeln: .Jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seiner Leistung.' — Wir gehen einer neuen Welt entgegen — der Welt des Kommunismus. Von diesem Weg werden wir niemals abweichen.1“ Sollte sich etwa diese künftige Welt des Kommunismus in den Demokratien mit sozial akzentuierter Marktwirtschaft schon abzeichnen? Auch als beispielhaft für die Sowjetunion? Gorbatschow war ehrlich genug, den ideologisch-theoretischen Diskussionen samt den dazugehörigen gewaltigen Erschütterungen nicht auszuweichen. Die Auseinandersetzungen darüber drangen weniger deutlich in die Öffentlichkeit als die Probleme der desolaten Wirtschaft, der laxen Arbeitsmoral, der Korruption. Doch die Umgestaltung in der Sowjetunion brachte gerade dadurch, daß sie die stärkste Resonanz bei allen intelligenten und aktiven Menschen fand, auch die Grundfragen des Marxismus in Bewegung. Mit welchem Ergebnis, wird sich erst in den kommenden Jahren zeigen. Gorbatschow meinte im Juni 1987 ohne Schönfärberei: „Die Hauptfrage in der Theorie und Praxis des Sozialismus besteht darin, wie auf sozialistischer Grundlage stärkere Stimuli des wirtschaftlichen, wissenschaftlich-technischen und sozialen Fortschritts als im Kapitalismus geschaffen und wie die planmäßige Leitung mit den Interessen der Persönlichkeit und des Kollektivs am effizientesten in Einklang gebracht werden können. Das ist eine überaus komplizierte Frage, auf die die Theorie des Sozialismus und die gesellschaftliche Praxis die Antwort gesucht haben und suchen. In der gegenwärtigen Etappe des Sozialismus wächst die Bedeutung dieser Frage ins Unermeßliche.“ A1s unermeßlich wird ihre Bedeutung aber auch außerhalb der Sowjetunion empfunden. Selbst wenn die innersowjetischen Probleme ausgeklammert würden, so zeigt selbst ein flüchtiger Blick auf die Veränderungen, zu denen es seit 1985 als Folge der neuen sowjetischen Politik gekommen ist, daß Michail Gorbatschow buchstäblich einen Sturm der Wandlungen ausgelöst hat. Was sich innerhalb der Sowjetunion auch als Neuentdeckung des Prinzips der persönlichen Selbstbestimmung beschreiben läßt, bedeutete außerhalb der UdSSR die bedingungslose Anerkennung des Selbstbestimmungsrechts der Völker. Die Sowjetunion nahm dafür eine Fülle zentrifugaler Kräfte innerhalb ihres Reiches in Kauf. Sie ermöglichte im Zuge einer tiefgreifenden Geschichtsrevision die Nationalisierung der baltischen Staaten. Sie überließ den Polen und Ungarn eine eigene Gestaltung ihrer Nationalität, Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung. Sie bestätigte sogar den Anspruch des deutschen Volkes auf Selbstbestimmung und schlug dadurch dem Weg zur deutschen Einheit die entscheidende Bresche, ein Vorgang, der die früheren, zumeist halbherzigen Bemühungen der westlichen Staaten seit den fünfziger Jahren in dieser Richtung degradierte — einschließlich aller diplomatischen Gaukeleien der Bonner Regierung, die sich als „Deutschlandpolitik“ präsentierten. Denselben freien Weg ermöglichte die sowjetische Regierung dem tschechischen und dem bulgarischen Volk, und sie verfolgte mit kaum verhohlener Genugtuung die blutige Selbstbefreiung der Rumänen. Die Selbstbestimmung — von den bedeutendsten Gelehrten als Markstein in der Entwicklung des Völkerrechts bezeichnet — ist heute die Basis der Legitimitätsbegründung politischer Herrschaft. Dies allein führte zu der „friedlichen Revolution“ der Deutschen in der DDR. Auch das Schwergewicht dieses Umbruchs, der sich im Sommer 1989 angebahnt hat, kann zur Zeit noch kaum abgeschätzt werden. Er beendet nicht nur in einem symbolischen Sinn eine Art babylonischer Gefangenschaft der Deutschen. Er zieht einen Schlußstrich unter die gesamte Politik seit 1945, und zwar nicht nur in Europa. Die Wiederherstellung der deutschen Einheit bedeutet das Ende der europäischen Zerspaltung, bedeutet mithin auch, daß ein neues europäisches Zeitalter seine Konturen erhält, bedeutet eine Renevatio Europas gemäß seiner historischen Traditionen und dem dazugehörigen Rang. So sicher, wie sich damit eine Reduzierung des amerikanischen Einflusses verbinden wird, so sicher wird es zu einer Stärkung der europäischen Gemeinsamkeit Rußlands mit den Völkern des Kontinents, in erster Linie mit den Deutschen kommen. Ein epochaler Anstoß dazu ergab sich auch aus der unbeirrbaren Kühnheit, mit der die Sowjetunion die nukleare Abrüstung mit dem Ziel der völligen Abschaffung der Atomwaffen in Gang setzte. Die veränderte weltpolitische Konstellation und Akzentuierung unserer Hemisphäre wird zunehmend deutlicher. Ihr Gegenstück hat sie in Fernost. Der japanische Premierminister Yasuhiro Nakasone prophezeite 1985 in einer Neujahrsüberlegung: „Das pazifische Zeitalter ist historisch unvermeidlich.“ Nicht nur Gorbatschow empfand die Bedeutung der Frage, wie es heute mit der Theorie des Sozialismus steht, als „unermeßlich“. Das war auch außerhalb Europas der Fall, und dort womöglich noch bedrängender als in der Sowjetunion. Denn sie, das „Mutterland des Sozialismus“, galt jahrzehntelang als unbestechlicher Anwalt der Entkolonialisierung, also der praktischen Verwirklichung der Selbstbestimmung. Daß dabei der Marxismus-Leninismus auch als erstrebenswertes Gesellschaftsmodell galt, entsprang weniger den realen Erfahrungen, sondern ergab sich eher daraus, daß Kolonialismus und westlicher Kapitalismus miteinander identifiziert wurden. Noch wichtiger aber waren die nahezu religiösen Erwartungen, die von allen Armen und Entrechteten der Welt mit den Lehren von Karl Marx und Friedrich Engels verknüpft wurden und bis heute noch immer verknüpft werden. Bis zum Jahre 1985 wurde die marxistisch-kommunistische Bewegung vom Glauben an eine historische Mission und von der Hoffnung auf ein Endreich irdischer Glückseligkeit in Marsch gehalten. Daß sich der überschwenglich verklärte, „real existierende Sozialismus“ als von Grund auf verrottet und totaler Fehlschlag erwies und dies von der Führung der Sowjetunion auch noch schonungslos bestätigt wird, bedeutet für aberhundert Millionen Arme auf dem Erdball den Zusammensturz einer Welt, deren erträumte Existenz ihnen den Alltag des Elends und der schreienden Not ertragen half. Wiederholt wurde im Verlauf des zwanzigsten Jahrhunderts von Prognostikern außerhalb des Marxismus das Ende aller Ideologien verkündet. Seit 1985 ist es in einer Form sichtbar geworden, deren ganze weltgeschichtliche Dimension zur Zeit ebenfalls noch nicht abzuschätzen ist. So irreführend, illusionär, unwahrhaftig und utopische Hoffnungen weckend der internationale, von Moskau geprägte Kommunismus auch gewesen sein mochte: Er galt in Asien, Lateinamerika, Afrika weithin als eine Richtsäule. Nunmehr wird auch dort die Wahrheit erkannt — freilich nur als Entlarvung. Deshalb handelt es sich um keine Wahrheit jenen Zuschnitts, die frei macht. Zunächst herrscht nur die negative Wirkung vor. Die Richtsäule ist vernichtet. Fast bis zur Verzweiflung verschärft sich die Lage in diesen X. Ländern durch die ungelösten Probleme der Übervölkerung, der Wirtschaft, des Außenhandels, der Verschuldung, der Unterernährung. Die reichen Industrienationen verspüren ihrerseits die zwanghafte Verkettung damit noch immer nur in abgeschwächter Form. Doch was schneller als vermutet begriffen wird, ist zumindest der Kern der gigantischen Veränderungen, die sich vor den Augen aller Erdbewohner abspielen, sofern ihr Blick nicht von Vordergründigem verstellt ist. Noch nie wurden in technischem Sinn größere Triumphe der naturwissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse gefeiert als heute, und noch nie war die Skepsis gegenüber dem humanen Wert derselben Erkenntnisse und die Furcht vor ihren Folgen so intensiv wie zu unserer Zeit. Was in Frage steht, ist nicht nur der Sinn des menschlichen Fortschritts, sondern dieser Fortschritt selbst. Anders ausgedrückt: Was berechtigt uns, wenn wir sämtliche Negativerscheinungen solcher Wissenschaften wie der Kernphysik, Chemie, Elektronik oder Pharmazie bedenken, den Fortschritt noch als ein Fortschreiten des Menschen in eine passable Zukunft zu bezeichnen? Damit aber stellt sich in einer wahrhaft bedrohlichen Intensität auch die Frage nach dem Menschenbild, nach der Position des einzelnen im globalen Zusammenhang, nach der Rechtfertigung seiner jeweiligen Gesellschaftsordnung vor dem Hintergrund der Gefährdung unseres Planeten. In der heutigen Welt stehen isoliert und dennoch eng zusammengehörig nebeneinander: grotesk unterschiedliche Wirtschaftsordnungen, Raubbau an den Ressourcen der Erde, zunehmende Ausrottung der Tierwelt, Verseuchung der Flüsse, Weltmeere und Atmosphäre, Auszehrung des christlichen Glaubens, Aufschießen von Regionalismus und Fundamentalismus, Unfähigkeit, der rapide zunehmenden Kindersterblichkeit einen Riegel vorzuschieben und ebenso der Unterernährung eines Fünftels der Weltbevölkerung, also nahezu einer Milliarde Menschen; ferner die Aussichtslosigkeit, bei diesen Problemen merklich über die Grenzen der bloßen Diskussionen auf Konferenzen hinauszukommen. Und als ob die Summe dieser Bedrückungen nicht genügen würde: Noch nie in der Menschheitsgeschichte war ein so weltweites Bewußtstein davon vorhanden, daß der Umbruch am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts zugleich eine Grenzscheide darstellt zwischen unserem Sein und dem Nichtsein. Gerade dadurch aber zeigt sich, daß bei aller Bedrohlichkeit doch der minimal benötigte Spielraum für energisches Handeln erhalten bleibt. Auch wenn dies in mancher Hinsicht so erscheinen mag, als ginge es darum, sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen. Läßt man den Geschichtsverlauf der letzten zwei Jahrhunderte anhand der markantesten Ereignisse Revue passieren, so erkennt man wiederholt einen verblüffenden Gleichlauf der Realität und der Ideen. Die erste industrielle Revolution wurde getragen von einem immensen Vertrauen zum menschlichen Fortschritt. Jede neue Erkenntnis und Entdeckung im neunzehnten Jahrhundert konnte als eine Bestätigung, als eine Erhärtung dieses Glaubens empfunden werden. Sowohl die sprunghafte Zunahme der Bevölkerung aufgrund der medizinischen Entdeckungen als auch die Bedingungen der neuen industriellen Arbeitswelt ließen die Sozialprobleme der bürgerlichen Gesellschaft entstehen. Ihre Dringlichkeit wurde erhöht durch die Reklamierung gerade jener Rechte, die in der Französischen Revolution vom Bürgertum für sich erkämpft worden waren, die sie aber in den ersten Etappen der Industrialisierung dem Arbeiter vorenthielt. Wissenschaftlicher Erkenntnisfortschritt, Industrialisierung und Sozialkampf sind nur verschiedene Aspekte eines historisch einheitlichen Prozesses. Der Westen mag zur Zeit nicht ohne Selbstgefälligkeit oder gar mit Hohn dem Zusammenbruch des Marxismus/ Kommunismus Beifall spenden. Er beweist damit nur das Ausmaß seiner eigenen Uneinsichtigkeit. Denn mit dem alten Sowjetsystem ging nicht etwa nur eine Ideologie oder eine gewaltsam für sakrosankt erklärte Theorie des Sozialismus zu Bruch, sondern in weiterem Sinn das ganze Prinzip der Machbarkeit aufgrund bedingungsloser Rationalität. Von eben diesem Prinzip lebte und lebt auch die westliche Technikgläubigkeit, lebt das unerbittliche Vertrauen zur menschlichen Vernunft als demjenigen Kompaß, der uns allein vor Irrwegen bewahrt Vermeintlich bewahrt. Fast meldet sich religiöse Rührung bei der Beobachtung, daß bei Auseinandersetzungen und Debatten über die heutigen Weltprobleme selbst auf Expertenkongressen das Ende regelmäßig eingebettet ist in feierliche Beschwörungen sittlicher Werte. Im breiten Mittelfeld behaupten sich durchweg Argumente, die entweder von wissenschaftlicher Kompetenz oder politischer Vernunft gestützt sind. Sobald aber Entscheidungen zu fällen sind, sondern sich die Geister. Auf der einen Seite stehen die Eigeninteressen, auf der anderen ethische Normen — sehr allgemein, deshalb sehr unverbindlich. Die strapazierte Ratio ist unterdessen von der Konferenz abgereist. Der Verhaltensforscher Konrad Lorenz zeigt das Dilemma: „Tiere können nichts, was sie nicht dürfen, aber der Mensch kann eine Menge Dinge tun, die er nicht darf. Deshalb sind alle Entscheidungen, an denen die Zukunft der Menschheit hängt, letztlich ethische Entscheidungen.“ Innerhalb welchen Wertesystems diese Entscheidungen zu treffen sind, das weiß allerdings auch Konrad Lorenz nicht: „Was heute verlangt wird, ist eine Umwertung aller Werte.“ Eine solche Umwertung hatte schon Friedrich Nietzsche vor hundert Jahren gefordert. Das Dilemma besteht darin, daß unsere Zukunft in der Tat von ethischen Entscheidungen oder einer „Umwertung aller Werte“ abhängt, daß aber niemand in der Lage ist, über den formalen Imperativ hinaus anzugehen, wie die neue Hierarchie der Werte aussehen müßte — ganz zu schweigen davon, wie sie durchzusetzen wäre. Wer die Regenwälder rodet, wie es zur Zeit in Lateinamerika oder Indonesien der Fall ist, handelt kriminell. Doch es ist ebenfalls kriminell, denjenigen Menschen nicht zu helfen, die sich nur durch wilde Rodung ein Stück bebaubares Land sichern können. Innerhalb des globalen Zwanges zu ethischem Verhalten ließe sich theoretisch ein ebenso heilloser wie sinnloser Zirkel kriminellen Verhaltens der Regierungen und Politiker nachweisen. Wer ohne dringende Not einen einzelnen Baum fällt, verletzt heute unser sittliches Empfinden. Doch einer Regierung, die in der Sintflut der Landesprobleme so wenig Prioritäten zu setzen weiß wie sonst irgend jemand auf der Welt, läßt sich nicht einfach kriminelle Untätigkeit anlasten, wenn sie kein Mittel gegen die Abholzung der Wälder besitzt. Konrad Lorenz macht auf das Axiomatische, nicht mit der Vernunft zu Begründende des ethisch Guten und Bösen aufmerksam. Sämtliche Erfahrungen der Geschichte zeigen allerdings, daß dies nur für den einzelnen Menschen gilt. Wer ein hilfloses Kind im Fluß treiben sieht, der weiß ohne Wenn und Aber, was er zu tun hat. Doch schon unser Leben in einem kleineren Gemeinwesen wird nur zum Teil von ewig geltenden Werten bestimmt — zu einem anderen Teil von Normen, deren Verbindlichkeit der jeweilige historische Zeitpunkt bestimmt. Daß unsere Zukunft heute „letztlich von ethischen Entscheidungen“ abhängt, ist richtig. Aber diese Einsicht verlangt auch gebieterisch nach Hinweisen, was in konkreten Fällen ethisch zwingend wäre. Dazu ist heute niemand in der Lage. Doch wir haben schon viel damit gewonnen, wenn wir unsere Situation nicht nur bis in den letzten Winkel der Bedrückung durchschauen können, sondern inzwischen auch weit davon entfernt sind, unserer Vernunft blind zu vertrauen. Von unserer Erkenntnisfähigkeit allein ist die Lösung aller Rätsel der Welt und ihrer Schwierigkeiten nicht zu erwarten. Mit dieser Tatsache verbindet sich auch eine kompakte Zuversicht. Sie wird am massivsten gestärkt von den fundamentalen Wandlungen in unserer Zeit Die Gefahren, die sie begleiten, scheinen vielfach von einer tödlichen Unausweichlichkeit zu sein. Resignation ist deswegen genauso unangebracht wie ein Optimismus, der allein auf der löblichen Eigenschaft des Menschen gründet, sich in ausweglosen Lagen mit den letzten Reserven an wilde Hoffnungen zu klammern. Wir müssen nämlich bei einer Bilanz dem Aufgebot jener Kräfte, die als Errungenschaften des wissenschaftlich-technischen Fortschritts unweigerlich zur Selbstzerstörung der Menschheit führen, die mächtigen Impulse entgegensetzen, die im Zuge des weltweiten Umbruchs am Ende des Jahrhunderts zur Wirkung gekommen sind. Wer dies nüchtern abwägt, kann durchaus der Gelassenheit und unbeirrbaren Energie das Wort reden. Die ungeheure Erschütterung, die vom Zusammenbruch des Bolschewismus ausgeht, wirft auch Hekatomben von politischen Begriffen, kulturellen Fixierungen und gesellschaftlichen Überständigkeiten zum alten Eisen, die wir samt und sonders in unserer Zeit als „modern“ bezeichnet haben, obgleich sie nichts anderes waren als Abkömmlinge oder theoretische Überzüchtungen von Problemen des Jahrhunderts zuvor. Nichts davon wird den bevorstehenden Jahrtausendwechsel überdauern. Das Ende einer Epoche überschneidet sich stets mit den Anfängen der neuen. Die Signatur unserer Zeit sieht etwas anders aus. Vom zwanzigsten Jahrhundert wird nicht viel ins nächste Säkulum reichen. Das einundzwanzigsten Jahrhundert aber hat schon lange begonnen. Begonnen nicht zuletzt im Zeichen eines bemerkenswerten Anknüpfens der geschichtlichen Entwicklung an ihre alten zeitlosen Fundamente und an Erkenntnisse, die sich über die Zeitalter hinweg bestätigen und sich abgewandelt in den großen Ereignissen niederschlagen. Geschichte ist eine beständige Realität. Wir unterliegen dem Geschehen, wir können uns aber gleichzeitig davon durch die Beobachtung distanzieren und dadurch seine Bedeutung erkennen — die Bedeutung, die es für sich selbst innerhalb einer größeren Entwicklung besitzt, ebenso seine Bedeutung für uns persönlich. Wenn wir vergleichen, mit welcher Sicherheit die Wissenschaften im neunzehnten Jahrhundert die Fülle ihrer Entdeckungen als Unterpfand einer großartigen Zukunft betrachteten und mit welcher Behutsamkeit und Vorsicht die Fachleute unserer Zeit allem gegenüberstehen, was als „Fortschritt“ gepriesen wird, sind „Nutzen und Nachteil der Historie“ auch für unser Leben leicht zu erkennen. Ob sich das mit Lehren verbindet, die sich handfest ausmünzen lassen, oder ob es sich um allgemeinere Schlußfolgerungen handelt, spielt keine Rolle. Wichtig ist allein, daß solche Vergleichsmöglichkeiten, wie sie uns nur die Geschichte bietet, unsere Erkenntnis genauso bereichert wie unsere Selbsterkenntnis; noch wichtiger ist die Zuversicht, die sie vermitteln, und zwar aufgrund des Selbstbewußtseins, das essentiell zur Entwicklung der Menschheit gehört. Der große Historiker und Feldherr seiner Vaterstadt Athen, Thukydides, konnte sicher sein, durch seine Darstellung des „Peloponnesischen Krieges“ seinen künftigen Lesern zuverlässige Lehren der Geschichte mitgeliefert zu haben. Diese unmittelbare Sicherheit, das schlichte Vertrauen zur Konstanz der menschlichen Natur und dem gleichbleibenden Wechsel zwischen Motivation und Aktion ist uns zwar weitgehend abhanden gekommen. Trotzdem findet sich darin etwas Gültiges. Es wird bestätigt durch die Mythen der Griechen. Bei ihnen liegt die Urquelle der Historie, der geschichtlichen Erkundung und des Berichts davon. Nichts symbolisiert auch bei dem Unterfangen einer Kartographie der Menschheitssituation am Ende des Jahrtausends unsere Lage besser als der Mythus von Prometheus. Er verkörperte die titanische Kraft, den Willen zum Schöpfertum und das urtümliche Aufbegehren gegen ein übermächtiges Geschick. Dem obersten Gott Zeus zum Trotz raubte er für den Menschen das Feuer, damit er die Welt nach seinen eigenen Vorstellungen formen konnte. Die unbegrenzte Entwicklung und Selbstdarstellung in den Künsten und Erfindungen, in deren historischer Dimension wir uns heute begreifen, gehört zum unvergänglichen Erbe von Prometheus und damit zum Geschick des Menschen. An Prometheus ist noch immer abzulesen, daß ein Übermaß des Erstrebten, das absolute Vertrauen zu unseren eigenen Kräften und das Durchbrechen sämtlicher Schranken, Maße und Grenzen zur Selbstzerstörung führt — doch ebenso ist an ihm abzulesen, zu welch großartigen Gestaltungen der Mensch zu allen Zeiten fähig war und immer fähig sein wird.
Polarstern des demokratischen Willens, leicht verkürztes Kapitel „Polarstern des demokratischen Willens“ aus dem Buch „Ein Querkopf braucht kein Alibi – Szenen der Geschichte”, sowie erschienen in: Geschichte Nr. 1 1991 Jan./Feb., Archiv Verlag, Braunschweig. Polarstern des demokratischen Willens Der Grundsatz „Alle Gewalt geht vom Volke aus“ gilt seit dem 2. Dezember auch für Deutschland. Die erste freie Wahl des ganzen deutschen Volkes ist ein Meilenstein der Geschichte Die Wahl vom 2. Dezember 1990 wird zwar inzwischen vom Alltag und der Weihnachtszeit überdeckt. Doch es war ein großes Ereignis. War es das wirklich? Während des Wahlkampfs ließen die ebenso gängigen wie wenig ermunternden Wortgefechte der Parteien kaum ein Empfinden dafür aufkommen. Empfinden dafür, daß es dem deutschen Volk noch nie in seiner Geschichte vergönnt war, sein Parlament in einer wirklich freien Wahl selbst zu bestimmen. Am 2. Dezember war dies der Fall. In den letzten 200 Jahren unserer Geschichte folgte ein dramatisches Geschehen dem anderen. Kriege, Revolutionen, Niederlagen, Siege, Umstürze, Triumphe und namenloses Elend reihten sich aneinander in der empfindungslosen Farbigkeit, die nun einmal typisch für die Historie ist. Die nachhaltigsten Wirkungen auf den Gesamtzustand der europäischen Völker hatte die Französische Revolution des Jahres 1789. Der dritte Stand, das Bürgertum Frankreichs, eroberte die politische Mach: die unbeschränkte Königsherrschaft wurde gestürzt. So wie 1989 in der DDR Hunderttausende die Revolutionsparole skandierten: „Wir sind das Volk“ - so behaupteten 200 Jahre zuvor die Sprecher do französischen Bürgertums: „Wir sind die Nation“. In ihrem berühmten Ballhaus-Schwur vom 20. Juni 1789 erklärten sie, nicht eher auseinanderzugehen, bis sie eine neue Verfassung beschlossen hätten. Die Nationalversammlung (Assemblée nationale) von 1789 wurde zum Modell auch für das erste deutsche Parlament, das im Revolutionsjahr 1848 am 18. Mai in der Frankfurter Paulskirche zusammentrat. Doch im Unterschied zu Paris fehlte der Paulskirchenversammlung der rücksichtslos revolutionäre Wille. So wenig, wie die Bürger der Französischen Revolution das gesamte Volk Frankreichs repräsentierten, so wenig vertraten die Abgeordneten des Jahres 1848 das ganze deutsche Volk. Frauen besaßen kein Wahlrecht; in den meisten Gebieten galt das auch für alle unselbständigen Berufe, für Tagelöhner und Dienstboten. Bauern waren in Frankfurt kaum, Arbeiter und Handwerker überhaupt nicht vertreten. Das Parlament der Paulskirche war eine Körperschaft von akademischen Honoratioren. Das Hauptverdienst des Frankfurter Parlaments war die Reichsverfassung vom 28. März 1849. Sie blieb allerdings nur auf dem Papier, denn die deutsche Revolution 18487/49 scheiterte. Die alten Regierungen ermannten sich nach den ersten Monaten des Schocks und rissen die Macht erneut an sich. Gegen Ende waren die meisten Abgeordneten nach Hause abgereist, der Rest spielte Domino und ließ sich dann von Soldaten auseinandertreiben. Immerhin wurde das Niveau, wurden die Argumente, die Reden und Debatten zahlreicher namhafter Abgeordneter der Paulskirche zu klassischen Beispielen der Möglichkeiten und Vorzüge des Parlamentarismus. Daß die meisten Ideen unseres ersten Parlaments nicht der politischen Wirklichkeit entsprachen, war ein Schicksal, das auch übermäßig vielen Abgeordneten bis hin in unsere Gegenwart des Jahres 1990 nicht erspart blieb. Das Wort Parlament kommt aus dem Französischen „parler – sprechen". Das Parlament ist ein Ort der Entscheidung durch das gesprochene Wort: durch die Reden und Gegenreden, die Dispute, die Aussprachen. Parlamentarisch regieren heißt nichts mehr und nichts weniger als durch das Wort regieren - „government by speaking“, wie es in England heißt. Die Parlamentsdebatten liefern der Kritik endlosen Stoff. Das Prinzip der parlamentarischen Öffentlichkeit garantiert, daß jede Art von Tadel bis hin zum hämischen Verriß möglich ist. Schon Karl Marx und Friedrich Engels bezeichneten in einem Pamphlet die Frankfurter Abgeordneten als „eine Versammlung alter Weiber" und die Nationalversammlung als „bloßen Debattierklub, bestehend aus einer Anzahl leichtgläubiger Tröpfe." Seitdem wird der oberste Grundsatz aller Parlamente, nämlich der öffentliche Disput, zum Aufhänger einer auf den ersten Blick treffenden, letzten Endes aber verfehlten Kritik. Dabei gehört der Vorwurf, Parlamente seien nichts anderes als „Schwatz - Buden", noch zu den milderen Formen der Verurteilung. Die Kritik an den allzu langen, allzu banalen, allzu niveauarmen Reden kann sich auch auf einen Umstand berufen, der in der Tat zu den Schwächen der Parlamente gehört: Sie sind gegenüber der Regierung in einer vergleichsweise machtlosen Position. Bismarck konnte als preußischer Ministerpräsident mit dem Abgeordnetenhaus in Berlin umspringen, als wäre es ein störrisches Zugpferd. Mit dem zweiten deutschen Parlament, dem Reichstag von 1871, verfuhr er kaum anders. Er behandelte die Fraktionen und Parteien, als wären es ausländische Mächte. Sobald ein Gegensatz aufbrach, betrachtete Bismarck das Parlament als ein zu mißbilligendes Übel. So meinte er am 26. November 1884 in einer Rede vor den Abgeordneten: „Ich lasse mir von der Majorität des Reichstags nicht imponieren. Ich habe mir ja von ganz Europa nicht imponieren lassen!" Im Unterschied zu 1848 war der Reichstag von 1871 aus gesamtdeutschen Wahlen hervorgegangen - allerdings unter Ausschluß der Deutschen in der Habsburgermonarchie, also vor allem in Österreich, Böhmen und Mähren. Es handelte sich immerhin um rund zehn Millionen Deutsche. Der Reichstag war zwar aufgrund eines allgemeinen Wahlrechts entstanden, doch auch diesmal durften Frauen nicht zu den Urnen. Bismarck hatte außerdem dafür gesorgt, daß die Verfassung des Deutschen Reiches auf ihn selbst, den Reichskanzler, zugeschnitten war. Sie trug dynastisch-autoritäre Züge, betonte Preußens Vorrang, das parlamentarische Element war sekundärer Natur. Über Jahrzehnte hinweg lernten die Parteien kaum etwas anderes, als Opposition zu spielen. Diese Tradition setzte sich zum Schaden der Weimarer Republik seit 1919 fort. Bismarck hatte sämtliche Möglichkeiten, die Politik alleine zu bestimmen. Dagegen bedeutete in der Weimarer Republik seit 1919 regieren: politisch zu handeln trotz des Parlaments. Zwar blieb auch für die Weimarer Nationalversammlung die Paulskirchenversammlung ein Vorbild, doch wurden diesmal die Abgeordneten nach dem Verhältniswahlrecht bestimmt; außerdem waren erstmals auch Frauen wahlberechtigt. Beim Verhältniswahlrecht entfiel auf 60.000 Stimmen ein Abgeordnetensitz. Dadurch wurden zwar die einzelnen abgegebenen Stimmen optimal berücksichtigt, aber die Folge war eine starke Zersplitterung dieses dritten deutschen Parlaments. Tragfähige Mehrheitsverhältnisse wurden dadurch außerordentlich erschwert - ein Grundübel des politischen Lebens in der Weimarer Zeit von 1919 bis 1933. Innerhalb von 14 Jahren wechselten die Regierungen 23mal. Die Weimarer Republik stand außerdem vom ersten Tag an unter dem Druck der alliierten Mächte, die den Ersten Weltkrieg gewonnen hatten. Verheerend wirkte sich der Versailler Friedensvertrag aus. Sämtliche Maßnahmen, die seine Durchführung garantieren sollten, hatten Vorrang vor der Reichsverfassung. Am 22. September 1919 erklärten die Sieger jeden Artikel der Weimarer Verfassung, der nicht mit Bestimmungen des Versailler Vertrages in Einklang stand, für ungültig. Dadurch wurde die Souveränität des Staates radikal beschnitten. Das deutsche Parlament des Jahres 1919 war ein Parlament in Ketten. Immerhin: Es war noch ein Parlament. Der Reichstag seit 1933 dagegen war nicht einmal dem Namen nach ein Parlament. Er sollte auch kein Parlament sein. Hitler hatte in der Weimarer Zeit jahrelang verkündet, daß er und seine Partei, die NSDAP, mit dem Parlamentarismus und der Demokratie brechen würden. Nach 1933 wurden die anderen politischen Parteien aufgelöst, die freien Wahlen durch Volksabstimmungen ersetzt. Dem Reichstag gehörten nur noch Nationalsozialisten an. Er war eine Versammlung von Menschen, die Beifall zu spenden hatten. „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus." Das große Wort steht in jeder modernen Verfassung. So ist es auch zu lesen im Grundgesetz der Bundesrepublik, Art.20. Seit der Französischen Revolution, seit mehr als 200 Jahren, ist dieses Prinzip ein Polarstern des demokratischen Willens. Wie aber sieht das in der Praxis aus? Auf welche Weise, in welcher Form wird die Staatsgewalt, die da vom Volk ausgeht oder ausgehen soll, sichtbar? Im Parlament, durch das Parlament: durch die Abgeordneten, die das Volk gewählt hat. Das Parlament ist der Ort, an dem die Volksvertreter das Mandat ihrer Wähler in die politische Wirklichkeit überführen, -überführen sollen. Das ist Pflicht aller Parteien, also nicht nur derjenigen, die aufgrund der Mehrheitsverhältnisse die Regierung stellen, sondern auch eine Pflicht der Minderheit, der Opposition. Ein Parlament, das heute als demokratisch gelten will, geht aus allgemeinen, gleichen, unmittelbaren, freien und geheimen Wahlen hervor, bei denen sich der Wähler unter mehreren Parteien entscheiden kann. Nur ein solches Parlament ist eine echte Volksvertretung. Der Bundestag, das Parlament Westdeutschlands, ging aus den Wahlen am 14. August 1949 hervor. Sie waren, wie es sich gehört, allgemein, unmittelbar, gleich, frei und geheim. Sie waren aber keine Wahlen des ganzen Volkes, denn die rund 17 Millionen Deutsche in der damaligen Sowjetzone konnten sich nicht beteiligen. Außerdem gingen Parlament, Wahlsystem, Gliederung und die wichtigsten Durchführungsbestimmungen auf Direktiven der Alliierten Besatzungsmächte zurück. Ob man das a. Schönheitsfehler oder als einen grundsätzlichen Mangel bezeichnet, ist unwichtig. Ausschlaggebend aber war, daß sich an der Wahl nicht das ganze deutsche Volk beteiligte. Deshalb wurde in der Präambel des Grundgesetzes versichert, die Westdeutschen hätten „auch für jene Deutsche gehandelt, denen mitzuwirken versagt war.'' Kein Wahlrecht garantiert, daß auch die Rechte des Volkes verwirklicht werden. Die repräsentative Demokratie läßt dem Einfluß des Volkes jenseits der Wahl keinen Spielraum. Das unterscheidet sie von der direkten Demokratie, wie sie in gewisse: Form der Schweiz eigentümlich ist. Die Verantwortung liegt deshalb im Parlamentarismus ganz bei den Abgeordneten, der vom Volk Gewählten. Den Wählern bleibt nichts anderes übrig, als zu entscheiden, ob sie ihr nachkommen oder anderen Interessen den Vorzug geben, die nichts mit den Rechten des Volkes zu tun haben. Wir wissen, daß es keine ideale Regierungsform gibt. Unter den vielen schlechten ist die parlamentarische Demokratie immer noch die beste. Und am besten an ihr ist die Tatsache, daß sie aus freien Wahlen des ganzen Volkes hervorgeht. Will's Gott, dann auch in Zukunft zu unserem Besten. Die Bundesrepublik hat sich vom ersten Tag ihrer Gründung an als eine staatliche Ordnung präsentiert, die nur für eine Übergangszeit gelten sollte. Im Jahre 1949 war nicht abzusehen, wie lange sie dauern würde. Spätestens seit Ende der 60er Jahre begannen sich BRD und DDR gleichermaßen in der Doppelstaatlichkeit einzurichten. An dieser Tatsache änderte sich auch durch die westdeutschen Sonntags-Versicherungen nichts, daß der Auftrag des Grundgesetzes, „in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden", fortbestehe. Denn in der praktischen Politik wurde dieses Ziel ausgeklammert. Zwischen dem heutigen Tag und dem gewaltigen Umbruch 1989 liegt erst ein knappes Jahr. Die Veränderungen, die in Deutschland stattgefunden haben, sind so fundamental, daß wir wohl erst nach langer Zeit begreifen werden, was sie für die europäische Staatenordnung bedeuten. Immerhin können wir vor dem Hintergrund der letzten eineinhalb Jahrhunderte, abschätzen, daß die Wahl vom 2. Dezember 1990, die erste freie Wahl des ganzen deutschen Volkes, das kaum noch unter der Oberhoheit fremder Mächte steht, in der Tat ein Meilenstein ist. Sie stellt deshalb auch ein Richtmaß für unser demokratisches Leben dar. |
|
[Home] [Bücher] [Herausgeber] [Erhältliche Titel] [Artikel] [Kontakt] |





