|
|
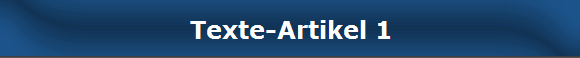 |
||||
|
|
||||
|
Texte von Artikeln Teil 1 Untenstehend findet sich der vollständige Text der folgenden Artikel: Verdammt zur Freiheit. Zum 60. Geburtstag Jean Paul Sartres am 21.Juni, in: Schaffhauser Nachrichten, 21.06.1965. Das Prinzip Gegenchronologie. Wie kann man Geschichte schreiben: Nur von den Anfängen her? in Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24.01.1979. Gegenchronologie vernichtet Langeweile, in: Lui, Nov. 1978. Deutschland - kein Wintermärchen. Wer die Geschichte eines Volkes kriminalisiert, macht es krank - Ein Gespräch mit Hellmut Diwald, in: Die Welt, 18.11.1978. Auch erschienen als Sonderdruck XII 1978. „Die grauenhaftesten Verbrechen unserer Geschichte“, in: Die Welt, 18.12.1978. Auch erschienen als Sonderdruck des Propyläen – Verlags unter dem Titel: „Geschichte im Widerstreit – Hellmut Diwald antwortet seinen Kritikern“ Sprache im Niemandsland. Die Schwierigkeit, einander zu verstehen, in: Rheinischer Merkur, Mai 1981. Was Würzburgs steinerner Löwe die Historiker lehren kann, in: Die Welt, 26.02.1983, auch erschienen als erstes Kapitel „Der Löwe am Stein“ im Buch „Mut zu Geschichte“. Zum 8. Mai 1945, in: Witikobrief, Folge 3, April/Mai 1985. Diogenes warf den Becher fort. Von Wert und Grenzen der Genügsamkeit, in: Rheinischer Merkur, 25.05.1985. Kein Ende der Symbole, in: Rheinischer Merkur, 21.06.1986. Die größte Seeschlacht der Weltgeschichte. Skagerrak: Der Mythos, die Wirklichkeit, das Vergessen, in: Mut, Nr. 231, Asendorf, November 1986. Lustgarten und Exerzierplatz. Ein Streifzug durch 750 Jahre Berliner Geschichte, in: Rheinischer Merkur / Christ und Welt, Nr. 34, 21.08.1987. Widerwillig beugte er sich unter die Krone des Reichs. Vom Kartätschenprinzen zum populären Pater patriae: Vor hundert Jahren starb Wilhelm I., Preußens letzter König und Deutschlands erster Kaiser, in: Rheinischer Merkur / Christ und Welt, Nr.10, 04.03.1988.
Verdammt zur Freiheit. Zum 60. Geburtstag Jean Paul Sartres am 21.Juni, in: Schaffhauser Nachrichten, 21.06.1965. Verdammt zur Freiheit Frankreich hat eine unausrottbare Neigung zur Gloire, auch jenseits des militärischen Bereichs. In den philosophischen Gemarkungen unseres Jahrhunderts hat Sartre diese Neigung Frankreichs glänzend befriedigt. Sartre war einmal Mode. Dann wurde er weltberühmt. Heute ist er der Grand Old Man des zeitgenössischen Denkens und für das westliche Europa der Jahrhundertmitte ein Symbol. War sein bisheriges Leben so, wie er es wollte? Im ersten Satz seiner grossen Baudelaire-Interpretation behauptet Sartre: «Er hat nicht das Leben gehabt, das er verdiente.» Und dann beweist er auf 160 Seiten, dass Baudelaire doch sein Leben verdient habe, so wie jeder Mensch das Leben hat, das er verdient. «Der Mensch ist, was er aus sich macht», das ist einer der bekannten, erregenden Befehlsthesen Sartres. Also ist es legitim, bei einem Existenzphilosophen danach zu fragen, was seine Existenz, was er selbst ist, und nicht nur danach, was seine Philosophie ausmacht. Nirgends ist das Junktim zwischen Lehre und Person so fest, so programmatisch wie im Existentialismus. Sartre gehört zu denjenigen Denkern, von denen man spricht, die aber nur ein kleiner Kreis Eingeweihter liest. Jedenfalls trifft das auf seine philosophischen Hauptwerke zu, vor allem auf sein berühmtestes: «Das Sein und das Nichts» (L’Etre et le Néant), das 1943 im besetzten Paris erschien. Aber den Philosophen Sartre muss man auch gar nicht lesen, um ihn zu verstehen. Kein Denker der Moderne hat mit so viel Worten so knappe Theoreme erhärtet wie Sartre. Das gehört zu seiner Genialität: Ihm kann das Geringfügigste zum Anlass werden, um Abgründe im menschlichen Dasein aufzureissen und um auf einem Strom von Worten zur Quintessenz eines Lehrsatzes zu schwimmen. Sartres Philosophie lässt sich in ein paar Sätzen formulieren. Er hat sie selbst in Thesen gefasst, die jedem Verstand, auch wenn er von keiner Fachsprache verbildet ist, sofort einleuchten: «Der Mensch ist, was er aus sich macht. Er ist zur Freiheit verdammt, nämlich zu der Freiheit, sich selbst auf seine Möglichkeiten hin zu entwerfen, aus seinen Möglichkeiten zu wählen. Der Mensch erhält seine Existenz nicht geschenkt, sondern er muss sie durch seine Wahl verwirklichen. Nur dadurch kann er seinem Leben, das wie ein Schiff in einem Meer des Absurden schwimmt, einen Sinn verleihen. Die Wahl schliesst die Pflicht zur Verwirklichung ein. Der Mensch wird danach beurteilt und gerichtet, ob er sein gewähltes Leben auch erfüllt. Der Mensch, und nur der Mensch allein trägt die Verantwortung für Sein und Sinn.» In den «Fliegen», Sartres erstem existentialistischen Drama und Thesenstück, bekennt Orest, nachdem er Aegis und Klytämnestra getötet hat: «Ich habe meine Tat getan, Elektra, und diese Tat ist gut. Ich werde sie auf meinen Schultern tragen, wie ein Fährmann die Reisenden durchs Wasser trägt. Und je schwerer sie zu tragen ist, um so mehr werde ich mich freuen, denn meine Freiheit, das ist die Tat.» Man sieht, Sartre ist kein Theoretiker, der vom Katheder aus über die konkrete Situation des Menschen hinweg ins Abstrakte philosophiert. Die Menschen sind frei, versichert er unentwegt, sie wissen es nur nicht. Man muss sie zum Bewusstsein ihrer Freiheit bringen. Dieser aktivistische Moralist hat niemals nur gelehrt, er hat immer missioniert, wenn auch weitgehend in Form von Dekreten. Sein Freiheitskonzept geht so weit, dass er um der menschlichen Würde willen einen radikalen Atheismus vertritt — es gibt keine Philosophie, die so konzessionslos diesseitig ist wie Sartres — und ebenso einen ethischen Rigorismus, der ihn auffällig von anderen existentialistischen Strömungen unterscheidet. Sartre ist kein «Professor für Angst und Sorge», wie man einmal gesagt hat. Denken ist für Sartre ein Medium zur Wandlung des Menschen. Deshalb ist Denken für ihn auch schon immer eine Tat. Durch die Artikulation des Gedachten, durch die Fixierung im Wort und seine Verbreitung, durch den immanenten sittlichen Appell verwandelt sich der Gedanke in Handlung. Das etwa liegt in dem heftig diskutierten Schlagwort von der «engagierten Literatur». Sartre hat niemals etwas gelehrt, was er nicht auch gelebt hätte, als Literat, als Journalist, als Widerstandskämpfer. Nicht zuletzt das macht seine bewundernswerte Grösse aus, eine Grösse, die nicht von Gnaden des Tagesruhms lebt, den Sartre reichlich genossen hat. Seit 1945 kannte ihn jeder, auch ausserhalb Frankreichs, man kannte ihn vom Theater, vom Film, von Kongressen, von seiner hemmungslosen Polemik, die aus seiner Zeitschrift «Les Temps Modernes» sprühte und deren Schonungslosigkeit Sartre in den verschiedensten Kreisen zum bestgehassten Mann machte. Immer war er unbequem, unbeliebt, geschmäht, denn er war entschlossen, die Wahrheit zu sagen, um jeden Preis, selbst um den der Gerechtigkeit. Mit Vorliebe berührte er offene Wunden, ätzend, ironisch, schroff — vom Indochina-Krieg über den Ungarn-Aufstand bis zum Terror in Algerien. Er benützte das Wort wie einen Sprengsatz, die OAS revanchierte sich mit einer Plastikbombe, die seine Wohnung zerstörte. Und nicht zuletzt kannte man Sartre von seinen dubiosen Verbeugungen vor dem Marxismus. Sartre stammt aus bürgerlichem Milieu. Bis zum letzten Atemzug, so hat er beteuert, würde ihn der Hass gegen den Bürger nicht verlassen. Man darf ihm das glauben. Sein Marxismus ist im wesentlichen ein affektives Aequivalent dieses Hasses. Sartres Freiheitslehre steht dem Marxismus unversöhnlich gegenüber wie Feuer und Wasser. Sartre glaubt sich so aus der Affäre ziehen zu können, dass er sich zwar zu den Grundlagen des Marxismus bekennt, aber dem seit vielen Jahrzehnten praktizierten Marxismus östlicher Provenienz erbittert vorwirft, er habe sich längst von diesen Grundlagen getrennt. Kein Wunder, dass Sartre von den etablierten und doktrinär eingefrorenen Kommunisten heftiger angefeindet wird als sonstige «bourgeoise» Denker. Sechzig gelebte Jahre, die Hälfte davon verbracht im Denken, Handeln, Kämpfen —, das garantiert, wenn es so bohrend radikal geschieht wie bei Sartre, die Aura säkularer Grösse. War (der Existentialismus nur Mode, Ausdruck der menschlichen Einsamkeit, der verzweifelten Weltverlorenheit in der Nachkriegssituation, dass also der Mensch nur sich selbst hat, worauf er seine Existenz gründen kann? Hat nicht gerade die breite der Zustimmung in Frankreich, in Paris, besonders der jungen Intellektuellen aller Sprachen, das Ephemere des Existentialismus, als einer blossen Zeiterscheinung, bestätigt? Dann bliebe also nur die Person Sartres übrig? Selbst wenn es so wäre, dann wäre es genug. Sartre ist ein bleibendes Stück des 20. Jahrhunderts, ein Stück Aufruhr und Unruhe, ein Skandalon für die geistige und moralische Behäbigkeit. Und Sartre wird das bleiben, solange er lebt. Man sollte ihm dafür danken, freilich nicht in Form einer unverbindlichen Reverenz, und auch nicht nur anlässlich seines 60. Geburtstages. GP
Das Prinzip Gegenchronologie, Wie kann man Geschichte schreiben: Nur von den Anfängen her? in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24.01.1979. Das Prinzip Gegenchronologie Unter den deutschen Historikern ist eine Auseinandersetzung ausgebrochen über die Frage, wie man Geschichte darstellen müsse. Chronologisch, entsprechend dem Lauf der Ereignisse? So war es bisher üblich. Vor kurzem hat der Erlanger Historiker Hellmut Diwald jedoch mit seiner heftig angegriffenen „Geschichte der Deutschen“ den Versuch gemacht, unsere Geschichte von heute her zu betrachten. (Siehe auch FAZ vom 5. Januar 1979) Im folgenden nimmt Diwald Stellung zu diesem Streit. “Es war einmal ... „ Der klassische Anfang der Märchen und Mythen ist der einfachen Erzählstruktur angepaßt, die zu den Eigentümlichkeiten von Märchen und Sagen, Legenden und Mythen gehört. In diesem Bereich finden sich auch die Ursprünge der Geschichtsschreibung. Sie setzt In Europa mit Homer und Herodot ein. Diese Tradition wurde im Laufe von mehr als zweieinhalb Jahrtausenden zunehmend rationalisiert und differenziert. Seit jedoch zu Beginn dieses Jahrhunderts von Niebuhr und Ranke die Grundsätze der quellenkritischen Forschung entwickelt wurden, trat an die Stelle des einfachen Erzählers der weitmöglichst abgesicherte Bericht. Das Zeitgerüst der Erzählung wurde den Erfordernissen des deskriptiven Verfahrens der Geschichtswissenschaft nicht mehr gerecht. Das Schema der Realzeit Durch Ihre Fixierung auf Daten, auf Feststellbares und Nachprüfbares als Ergebnis der Arbeit an den Quellen näherte sich die Geschichtsschreibung einer Form des Verlaufsreferierens, die sich dem festliegenden Schema der Realzeit anzupassen bemühte. Unsere Zeitordnung entstammt dem mechanisch – kosmischen Geschehen; nur ihm verdankt der Zeitfluß seine unaufhebbare Gleichförmigkeit. Da sieh jedoch das historische Geschehen mit seiner niemals vollständig zu erfassenden Fülle von Bestimmungselementen und Motivationen, Querverbindungen und Wirkungssträngen einem Berichtsduktus entzog, der sich konsequent an der Chronologie ausrichtete, wurde die Deskription erweitert durch argumentative Einschübe, Rückgriffe, mit dem Geschehensbericht verkettete Exkurse, Schlußfolgerungen allgemeiner Art oder Analogien. Geschichtsschreibung entwickelte sich zu einem mühevollen Gliederungsproblem denn Formung des Stoffes bedeutete in der Praxis die Ereignisse, Personen und Entwicklungen in der unerschöpflichen Vielfalt ihrer Verflechtungen darzustellen. Dies gelang nur, wenn das chronologische Schema aufgebrochen und lediglich zu einem Rahmen wurde. Die kritische Geschichtswissenschaft begann mit einem Affront gegen die im Dienst pädagogischer Moralität stehende Geschichtsschreibung der späten Aufklärung, welche sich der Vergangenheit annahm, um „die Mitwelt zum Nutzen zukünftiger Jahre zu belehren“. Ranke stellte dagegen die neue Forderung: Der Historiker solle „bloß zeigen, wie es eigentlich gewesen“. Dieser Satz wurde zum Kern der Diskussionen über die Art der Realitätsgegebenheit und der Objektivität in der Geschichtswissenschaft. Das Problem der historischen Wirklichkeit und unseres Verhältnisses zu ihr war nicht nur eine akademische Angelegenheit der Geschichtswissenschaft. Wahrend des 20. Jahrhunderts, zumal in Deutschland, wurde keine Universitätsdisziplin ein derart wesentliches Moment des politischen und gesellschaftlichen, kulturellen und religiösen Geschehens wie die Historiographie. Nach der Katastrophe des Jahres 1945 begannen die Deutschen, die sich bis dahin wie Jedes andere Volk mit ihrer Geschichte identifiziert hatten, eine solche Gleichsetzung abzulehnen, da sie aufgrund der Ereignisse während des Hitler – Regimes nicht mehr imstande waren sie zu vollziehen: das führte bis zur völligen Abkehr von der Geschichte überhaupt. Diese Haltung, die allerdings in der jüngsten Zeit weitgehend revidiert wurde, hängt zum Teil mit unserer politischen Lage zusammen. Seit einem drittel Jahrhundert gibt es für die Deutschen kaum eine dringlichere Frage als jene nach ihrer historischen Selbsteinschätzung. Die Unsicherheit in diesem Bezirk erweist sich an den heftigen Reaktionen, zu denen es unvermittelt kommt, sobald jemand auf das Kontroverse darin aufmerksam macht. Sie sind schroff genug, um an Goethes melancholische Bemerkung über Amerika denken zu lassen: „Dich quält nicht im Inneren / zu lebendiger Zeit / unnützes Erinnern / und vergeblicher Streit.“ Während es sich in den Nachkriegsjahren bei der Beschäftigung mit unserer Geschichte zu Recht um eine Hürde der Bilanz handelte, kommen wir heute zu der Einsicht, daß Geschichte konstitutives Moment der Gegenwart ist. Eine solche Realitätserfahrung hängt unmittelbar zusammen mit der historischen Wirkung. Ebendiese Erfahrung – als unmittelbare Teilhabe an der Geschichte, die sich dem willentlichen Einfluß entzieht und dem einzelnen meist in der Form des Erleidens widerfährt – entriegelt auch den direkten Zugang zur Geschichte. Die Erfahrung von solcher Wirklichkeit, zumal wenn sie nicht isoliert bleibt, kann zum Erlebnissubstrat von Geschichte werden. Die Verständigungsmöglichkeit über historische Realität setzt nämlich eine soziale Gemeinsamkeit des Erlebens, der Auffassung von geschichtlicher Wirkung voraus. Dieser Effekt ergibt sich aus dem elementaren Betroffensein durch die greifbaren Auswirkungen der Geschichte: Wirklich ist, was wirkt. Von diesem Modus der historischen Wirklichkeit wird auch unser Bezug zu ihr bestimmt. Sofern Geschichte mit einem Strom des Geschehens zu tun hat oder sofern sie damit verglichen werden kann, befindet sich jede Gegenwart, auch unsere des Jahres 1979, an der Mündung des Stroms. Gewöhnlich wird historische Beschäftigung mit einer rückwärtsgewandten Haltung gleichgesetzt. In der praktischen Arbeit sieht das anders aus. Der Historiker lebt genauso in der Gegenwart wie jeder andere: sein Vorstellungsbereich, seine verbalen und psychisch mentalen Ausdrucksmöglichkeiten hängen von den Gegebenheiten der zeitgenössischen Moderne ab. Trotzdem setzt er viele Jahrhundert vorher bei dem an, was er zur Quelle unseres Geschichtsflusses erklärt hat und arbeitet sich nunmehr im Schlepptau der aufeinanderfolgenden Jahreszahlen wieder zu seiner und unserer Gegenwart zurück. Was „als Blick in die Vergangenheit“ bezeichnet wird, ignoriert die Situation des Betrachters. Wer von der Erfahrung der Geschichte als einer Erlebnisrealität ausgeht, für den ist die Richtung entgegen dem Zeitverlauf, dessen Gleichmaß vom Umlauf der Planten abgemessen wird, der natürlichste Zugang zur Geschichte. In derselben Haltung fragen die Jüngeren ihre Eltern nach ihren eigenen Lebensumständen, als nächster Schritt folgt die Frage nach den Großeltern und so fort. Im ersten Moment erscheint die Behauptung „Geschichte ist Gegenwart“ paradox zu sein. Den Realverhältnissen entsprechend ist jedoch nicht die Gegenwärtigkeit des Vergangenen eine Fiktion, sondern dasjenige, was der Begriff Gegenwart bezeichnen soll. Unter dem Aspekt des unteilbaren Gleichflusses der Realzeit ist das „Jetzt“ immer schon vorbei. Gleichwohl ist die Gegenwart für den Menschen das einzige, was Wirklichkeit besitzt. Und aus diesem Grund können die traditionellen Geschichtsdarstellungen dem Zeitfluß nur in der Haltung des Als – ob folgen. Der Historiker ist nur deshalb in der Lage den Ablauf zu rekapitulieren, weil „Zeit“ nicht nur Realzeit, sondern auch eine Anschauungskategorie des Menschen ist. Sie allein ermöglicht ihm die Freiheit des Blickes in die Zukunft (als Voraussicht) genauso wie in die Vergangenheit. Ob man bei der Darstellung der Realzeit gleichlaufend verfährt oder gegenchronologisch: weder im ersten noch im zweiten Fall wird gegen das Prinzip des unabänderlichen Gleichmaßes der Realzeit verstoßen. Die Freiheit, die sich unabhängig von der Verlaufsrichtung in den Zeiten und durch die Zeiten zu bewegen, gehört wesensmäßig zur Anschauungszeit. Prospektive Vorgriffe ins Kommende gehören dank unserer Anschauungskategorien genauso zu unseren Möglichkeiten wie die Vergegenwärtigung des Vergangenen durch Hinwegsetzen über den Zeitverlauf oder durch sein imaginiertes Nachvollziehen. Dabei gibt es keinen Vorrang irgendeiner dieser Möglichkeiten. Für welche man sich entscheidet, bestimmt allein die Absicht, die sich damit verbindet. Die gegenchronologische Geschichtsschreibung kann deshalb keine Grundposition der traditionell arbeitenden Historie in Frage stellen. Andererseits kann auch sie selbst nicht in Frage gestellt werden. Es geht bei ihr lediglich um den entschiedenen Ansatz bei der unmittelbaren Realitätserfahrung von Geschichte. Dem gegenchronologischen Prinzip wurde vorgehalten, es mache die Geschichte sinnlos. Wann hätte die Geschichte jemals die Instanz der Sinnlosigkeit in sich selbst, kraft eigener Zuständigkeit getragen? Und seit wann würde durch den bloßen zeitlichen Zusammenhang auch der Sinnzusammenhang gestiftet? Im Zeitablauf selbst steckt keinerlei strukturierende Kraft, so wenig, wie jedes beliebige Geschehen eo ipso zu Geschichte wird – so wenig, wie die Kohärenz der Geschichte zeitlicher Natur ist. Auch der traditionell verfahrende Historiker muß unabhängig von Zeitablauf die genuin historischen Bezüge auf Bedingungsverhältnisse herausarbeiten. Er befindet sich dabei in keiner anderen Lage, als wenn er gegenchronologisch vorginge. Das Verhältnis von Ursache und Wirkung gilt ausschließlich für das Naturgeschehen. Das historische Geschehen ist weder durch den Zeitverlauf bestimmt noch durch den Kausalnexus. Bei ihm geht es um konstruktive Zwecke, Ziele, Interessen, Absichten, die vom Menschen gesetzt sind. Deshalb ist historische Arbeit vor allem Interpretation; sie hat nichts mit dem Aufzeigen unerschütterlicher Determinanten zu tun. Danach also deswegen Der Schluß von der zeitlichen Abfolge der geschichtlichen Ereignisse auf einen Kausalnexus gehört zu den schwersten Irrtümer der Historiographie. Durch beständige Anwendung der Formel post hoc, ergo proper hoc, wird in der Geschichtsschreibung der Eindruck erweckt, als wären die Historiker imstande, anhand eines zwingenden Ineinanders von Zeitverlauf und Kausalität die Folgerichtigkeit von der geschichtlichen Ereignisse zu beweisen. Solche Fehlschlüsse werden noch zusätzlich verknüpft und verwischt mit Hilfe der richtigen Feststellung, daß allem menschlichen Handeln eine Motivation zugrunde liegen müsse. Zwischen dem Motivationsgesetz und dem Kausalitätsprinzip läßt sich jedoch kein Begründungszusammenhang deutlich machen. In der Geschichtsschreibung wird dieser Formel deshalb so häufig gefolgt, weil sich aus den historischen Urteilen die Zeitbestimmung nicht ausschalten läßt und die irreversible Folgeordnung dazu verführt, dem historischen Realprozeß Abhängigkeiten bedingter Art einfach hinzuzufügen. Das gegenchronologische Prinzip neutralisiert aufgrund aufgrund seiner Umstellung der Folgeordnung weitgehend solche Versuchungen. Die Rekonstruktion des Geschehens und seiner Darstellung bleibt unbelastet von zwanghaften Nötigungen. Die Freiheit der Blickentfaltung die zur Gegenchronologie gehört, ermöglicht die Auffächerung der unterschiedlichen Möglichkeiten, die einem Ereignis vorlagen. Mit dem Bild des Flusses ausgedrückt: Wer stromabwärts fährt, sieht entsprechend dem Gefälle nur die Einmündungen der Nebenflüsse; der Hauptstrom treibt ihn daran vorbei. Wer dagegen stromaufwärts zieht, kann die Nebenflüsse kaum übersehen; sie kommen gemäß seiner Blickrichtung genauso in sein Gesichtsfeld wie der Hauptstrom. Zusammenhang und Sinn An meiner „Geschichte der Deutschen“ wurde beanstandet, ich hätte das gegenchronologische Prinzip nicht konsequent durchgeführt: wiederholt würden sich ganze Kapitel an die zeitliche Abfolge halten. Eine solche Kritik zeigt, wie einige Traditionshistoriker in der Schneise des einseitigen Kausalnexus und der Realzeit eingeschliffen sind. Sie sehen im gegenchronologischen Prinzip nur das Negative des eigenen linearen Verfahrens. Jede Art von Historiographie, die auf Differenzierung achtet, berücksichtigt sorgfältig die Krümmungen, Querverbindungen, Anhängigkeiten. Gleichgültig ob man den Strom aufwärts oder abwärts zieht: Wer die Windungen des Flußbettes vermessen will, muß in jedem Fall etappenweise arbeiten. Er muß immer wieder anhalten, muß vor- und zurückblicken, muß gemäß den übliche Meßverfahren die Lage eines Neupunktes durch Visuren von bereits bekannten Festpunkten aus bestimmen oder vom Neupunkt aus die Richtungen nach den bekannten Festpunkten messen. Weil die Gegenchronologie von der geschichtlichen Wirkung ausgeht, ist sie nicht gehalten, ihre Berichts- und Erzählform dem objektiven Zeitverlauf anzupassen. Sie bedient sich elliptischer Zeitschleifen, verfährt in mäandrischen Wendungen, operiert mit Rückblenden und Vorgriffen, mit Problemzergliederungen, greift zu Rekapitulationen, wenn es die Systematisierung eines Sachverhaltes erfordert. Wo die Ereignisse sich in dramatischer Verdichtung häufen, drängt sich die Rekonstruktion anhand des Realverlaufs als eine Selbstverständlichkeit auf. Der Erzählstruktur, so komplex sie auch sein mag, fällt bei der der praktischen Durchführung des gegenchronologischen Prinzips eine wichtige Rolle zu. Zur Substanz der unermüdlich beschworenen „Freiheit der Wissenschaft“ gehört es, keine Gewohnheiten von vornherein für sakrosankt zu erklären. Wo dies trotzdem der Fall ist, verlangt es die Rechtschaffenheit, dagegen zu verstoßen. Ein Historiker, der nicht seinen Anspruch auf eigene Urteilsbildung wahrnimmt, verwirkt ihn; so wie jeder andere Zeitgenosse auch. Sicherlich verlangt das Prinzip Gegenchronologie bei der Lektüre, daß man sich von einigen Gewohnheiten trennt. Die Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben, sind jedoch kein grundsätzlicher Einwand gegen das Prinzip selbst. Ob sich mit Hilfe der Gegenchronologie neue Durchblicke zur Geschichte hin öffnen – für ein Fazit ist es noch zu früh. Bis jetzt fanden Tausende von Lesern an dem Text noch nichts verwirrend. Eine der Hauptabsichten des Buches bestand darin, möglichst viele darin anzuregen, ihr Verhältnis zur eigenen Geschichte zu überdenken – sei es als Problem, sei es, daß sie sich ihrer Geschichte erneut vergewissern und damit auch ihrer selbst. Letzteres käme, auf dem Weg zu Allvertrautem, wenn auch übermäßig lang Vergessenem, der Entdeckung einer neuen Wirklichkeit gleich.
Gegenchronologie vernichtet Langeweile, in: Lui, Nov. 1978. Gegenchronologie vernichtet Langeweile Hellmut Diwald, 49, Geschichtsprofessor und Autor überdurchschnittlich erfolgreicher historischer Sachbücher, begründet hier, warum er seine neueste »Geschichte der Deutschen« (Propyläen Verlag) in der Gegenwart beginnen und vor mehr als tausend Jahren enden läßt. Spezialisierung war eine Voraussetzung der gewaltigen Erfolge der modernen Wissenschaften. Bezahlt worden ist dafür mit der zunehmenden Selbstisolierung der Forschungsbereiche. Jeder von uns hat sich schon geärgert über den Jargon der Spezialisten - ob sie am Elektronensynchrotron arbeiten, in der Neurologie, als Mediävisten oder in Transplantationszentren. Die Pforten der Erkenntnis öffnen sich nur Insidern. Moderne Wissenschaft ist esoterisch. Typisch für sie ist außerdem die Entschiedenheit, mit der sie den Menschen in den Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit stellt. Das hat ihr früheres Bild verändert. Sie zeigt heute alle Merkmale eines Spiegelcharakters. Wir handhaben sie als Instrument der Selbstentdeckung: von der Anthropologie über Pädagogik, Soziologie, Psychoanalyse bis zur Historie, Sexualwissenschaft und Theologie. Damit wird es paradox. Die Wissenschaften haben durch ihre Spezialisierung die Brücken der Verständigung eingerissen. Zwischen Profi und Nichtprofi klafft eine Schlucht. Drüben stehen die Experten, die sich auf die Erforschung »des Menschen« konzentrieren, hüben stehen die Menschen selbst. Sie wissen, daß man sich drüben mit ihnen befaßt, aber die Fachleute tun, als ginge sie das nichts an. Die Menschen werden nicht informiert. Das Paradoxe wird zum Absurden durch einen dritten Punkt. Heute gibt es kaum noch Wissenschaften, deren Forschungsergebnisse nicht praktisch umgesetzt werden und sich damit direkt auf uns auswirken: auf unsere Gesundheit, unsere mentale Verfassung, unser Zusammenleben. Das moderne Informationsbedürfnis, das meistens nichtswürdig ignoriert wird, ist deshalb keine Kinderneugier, sondern ein fundamentaler Anspruch. In dieser Situation steckt jede Disziplin, auch meine eigene, die Geschichtsforschung. Bei uns kommt zu der Aufsplitterung in Spezialfächer noch hinzu, daß der Geschichtswissenschaft in Westdeutschland ein gemeinsamer Nenner fehlt. Ob das ein Mangel ist, soll man nicht anhand der Tatsache entscheiden, daß die Historiker der DDR auf den gemeinsamen Nenner einer offiziellen Marxismusversion festgelegt sind. Früher hat es große Historikerschulen gegeben - Autoritäten wie Ranke oder Sybel, und man hat immer Geschichtsbilder gehabt: das nationalliberale, katholische, großdeutsche, preußische und so weiter. Heute wird unsere Geschichtswissenschaft wesentlich nur durch die Ausdauer zusammengehalten, mit der sie drei Probleme diskutiert: Die Krise der Geschichtswissenschaft - Das Schwinden des Geschichtsbewußtseins - Der Konnex zwischen Geschichtsforschung und Öffentlichkeit. Das Verlangen, der Impetus nach Geschichte, gehört zu unseren Urbedürfnissen. Warum drängen sich Aberhunderttausende in die Ausstellungen, zu den Staufern, zum »blauen Kurfürsten« Max Emanuel, zu Karl IV.? Der neutrale Begriff »Information« deckt diesen Urtrieb nur unter dem Wissensaspekt ab. Zugrunde liegt ihm derselbe Impuls, der schon vor bald 3000 Jahren den alten Rhapsoden und Geschichten-Erzählern vom Schlage Homers das Publikum in Scharen zugetrieben hat. Unsere Urgroßväter hatten mit der Geschichte noch keine Schwierigkeiten. Kein Streit im Bücherschrank zwischen Grimms Hausmärchen, den historischen Romanen Walter Scotts und dem ledergebundenen Nationalpathos Heinrich von Treitschkes. Seit 1945 ist das bei uns kompliziert. Im Jahr der bedingungslosen Kapitulation haben wir nicht nur den gigantischsten Krieg der Weltgeschichte verloren, sondern sind auch mit der Verantwortung für seinen Ausbruch und für alle Verbrechen der damaligen Regierung beladen. Damit hatten wir sie los, unsere Historie. Wenn ihr wirklich nichts anderes abzugewinnen ist als eine Bestätigung der eigenen Nichtswürdigkeit, dann war es richtig, sie zu ignorieren und den Geschichtsunterricht an den Schulen mit amtlichem Segen demolieren zu lassen. Inzwischen sind drei Generationen vergangen. Wir haben bemerkt, daß da etwas nicht stimmt. Besonders die Jüngeren wollen es genauer wissen, sie sind nämlich auffallend geprägt von drei typischen Eigenheiten unserer Zeit: einem beweglichen Intellekt, einer ungehemmten Phantasie, einem intensiven Wirklichkeitsverhältnis. Die Schwemme der historischen Bücher in den letzten Jahren bestätigt diesen Befund. Das bringt den Leser und den Historiker auf eine neue Art zusammen. Die Geschichte ist oft mit einem Strom verglichen worden, aus guten Gründen. Wenn das stimmt, dann ist die Gegenwart nichts anderes als die Mündung dieses Stroms, und an dieser Mündung stehen wir jetzt. Das heißt: Unsere Gegenwart ist Geschichte in ihrer stärksten Wirklichkeitsverdichtung, nämlich als aktuelles Zeitgeschehen. Wir erfahren sie am eigenen Leib. Die Geschichte der Deutschen beginnt folglich in den 70er Jahren der Gegenwart, geht durch die beiden Weltkriege, das Wilhelminische Zeitalter, durchs 19. Jahrhundert und so fort bis zum Jahr 919, als die deutschen Stämme den Sachsenherzog Heinrich I. zum König des ersten deutschen Reiches gewählt haben. Dieses gegenchronologische Verfahren der Geschichtsdarstellung bricht mit einer Methode, die seit zweieinhalbtausend Jahren festliegt. Aber ich kann nicht sehen, wieso das Alter des Verfahrens ein Argument ist für seine Schlüssigkeit. Mit Rücksicht auf den Wirklichkeitsgehalt und die Wirksamkeit der Ereignisse kann man ihre Kontinuität im Grunde nur verständlich machen, wenn man die Geschichte entgegen dem mechanischen Zeitablauf niederschreibt. Der Kalender, das starre Aufeinanderfolgen der Daten und Jahreszeiten hat weit mehr mit Gärtnerei, Landwirtschaft und Wintersport 7,11 tun als mit der Geschichte. Die Gegenchronologie erspart der Phantasie des Lesers die Langeweile. Ein Historiker kann nicht einfach behaupten, Geschichte sei aufregend und interessant. Das wäre Berufsoptik. Der Leser soll und muß vom Geschichtsschreiber einen Beweis für seine Behauptung verlangen.
Deutschland - kein Wintermärchen. Wer die Geschichte eines Volkes kriminalisiert, macht es krank - Ein Gespräch mit Hellmut Diwald, in: Die Welt, 18.11.1978. Auch erschienen als Sonderdruck XII 1978. Deutschland - kein Wintermärchen „Kaum vier Wochen auf dem Markt, macht die „Geschichte der Deutschen“ des Erlanger Geschichtsprofessors Hellmut Diwald (49) bereits Furore. Mit einer Startauflage von 100.000 Exemplaren hat der Propyläen – Verlag das 760-Seiten-Werk herausgebracht. Schon jetzt können die Berliner Buchmarkt-Strategen frohlocken, beim Buchhandel lasse sich ein Echo registrieren, „das ganz außergewöhnliche Erfolge wie etwa mit den Büchern von Speer oder Fest erwarten läßt“. Diwald traf, so scheint es, den Nerv: Die deutsche Geschichte ist ihm nicht länger „eine Einbahnstraße ins Verhängnis“. Er nimmt sie aus dem Bereich der Verdammungsurteile der Zeit nach 1945 heraus und stellt historische Fragen neu — nüchtern, aber mit dem Mut zum Unbequemen, ohne Scheu vor Tabus. Den Lesern will er den Blick öffnen für Gemeinsamkeiten aller Deutschen, „die sich nicht durch innerdeutsche Grenzen auseinanderschlagen lassen“. Über Ziel und Bedeutung seines Buches sprach mit dem Autor Hellmut Diwald unser Mitarbeiter GÜNTHER DESCHNER. WELT: Der aufregendste Teil Ihres Buches ist sicher Ihr Bericht über die deutsche Nachkriegspolitik. Warum lassen Sie Ihre Darstellung der deutschen Geschichte in den siebziger Jahren beginnen? DIWALD: Ich will eine neue Tür zur Geschichte aufmachen. Wir setzen uns nicht in die Zeitmaschine und fliegen zu den alten Germanen zurück und fangen dann an, der Zeit nachzulaufen. Sondern ich will ausgehen von der Betroffenheit des einzelnen von der Wirkung der Geschichte. Jeder, ob er will oder nicht, steht in einem direkten Kontakt mit der Vergangenheit, er erlebt und erleidet ihre Wirkungen. WELT: Haben Sie deswegen speziell mit der Realität der deutschen Frage begonnen, den Ursachen und Wirkungen der deutschen Teilung? DIWALD: Mein ganzer methodischer Ansatz, den ich das gegenchronologische Verfahren nenne, geht aus von der ganz massiven Realität der Geschichte, dem, was wir ganz konkret hier und heute spüren. Und das ist nun einmal in der Bundesrepublik die Deutschlandpolitik. Wenn ich etwa einen Verkehrsvertrag aushandele, dann stehe ich bereits mitten in einer geschichtlichen Entwicklung, die mich – wenn ich zu fragen beginne – zu der Frage zwingt, wieso Deutschland heute in mehrere Staaten gespalten ist. WELT: Sehen Sie in der Tatsache, daß Ihr Buch gerade jetzt in einer so hohen Auflage herauskommen kann, ein Signal dafür, daß die Deutschen wieder über sich und ihre Zusammengehörigkeit als Volk nachzudenken beginnen? DIWALD: Unbedingt. Wir haben eine völlig neue Freiheit zur Geschichte und wollen sie auch nutzen. Vor allem haben wir eingesehen, daß Geschichte für uns als Volk völlig unentbehrlich ist. Ohne Geschichte kann man geistig krank werden. WELT: In der Geschichtslosigkeit der Nachkriegsdeutschen hat sich die deutsche Misere offenbart. Welche Folgen hat diese Geschichtslosigkeit für den sozio – kulturellen Zusammenhang des deutschen Volkes gehabt? DIWALD: Wenn Sie deutsches Volk sagen, dann meinen Sie doch nicht nur die Bürger der Bundesrepublik. WELT: Ich meine das so, wie Sie es im Vorwort Ihres Buches geschrieben haben: die Bewohner der drei deutschen Republiken. DIWALD: Also die Bewohner der Bundesrepublik, der DDR und Österreichs. Mit den letzten fangen wir unsere Betrachtung an: Österreich ist aufgrund seiner relativen Kleinheit gut dran. Das nationale Vakuum, in dem die Österreicher stehen, wird ihnen deswegen nicht so deutlich bewußt. Außerdem können sie immer noch von dem zehren, was sie historisch einmal waren, ohne das Verhältnis zu Deutschland, zum Reich, zur nationalen Frage überstrapazieren zu müssen. Auch daß sie durch den Staatsvertrag auf eine bestimmte Rolle einfach festgelegt sind, führt dazu, daß sich die deutsche Frage bei ihnen nur verhalten stellt. WELT: Das ist bei der mitteldeutschen Republik anders? DIWALD: In der DDR ist die Geschichte in eine bestimmte Richtung gedrängt worden. Man will einerseits von der Zusammengehörigkeit aller Deutschen nichts mehr wissen. Andererseits nimmt der mitteldeutsche Staatsverband für sich in Anspruch, die Vollendung der wahren, der eigentlichen deutschen Geschichte darzustellen, die staatliche Verkörperung der besten Traditionen der deutschen Geschichte zu sein. WELT: Wie drückt sich das aus? DIWALD: Man hat dort zum Beispiel ein zwar staatlich sanktioniertes, aber auch bei der Bevölkerung ganz selbstverständliches Verhältnis zu den preußischen Reformen. In der Bundesrepublik hingegen hat man sich gedreht und gewendet und weiß eigentlich heute noch nicht, was man mit Scharnhorst, Gneisenau und dem Freiherrn vom Stein beginnen soll, und wir klammern sie deswegen einfach aus.
DIWALD: Hier sind die Probleme am schwierigsten. Denn die Bundesrepublikaner haben zum großen Teil in der Phase der Reeducation, der Umerziehung, ein gebrochenes und in seinem Gehalt moralisch abqualifizierendes Verhältnis zur deutschen Geschichte erhalten. WELT: Das betrifft vor allem die Darstellung der jüngsten Geschichte? DIWALD: Eben nicht. Das Verhältnis zu unserer Gesamtgeschichte wurde vergiftet. Im Bereich der Geschichte wurde ein beinahe lückenloser Kehraus praktiziert, der sich nicht nur auf die direkten und mittelbaren Vorfahren, sondern auf die ganze deutsche Vergangenheit erstreckte. Die Geschichte der Deutschen wurde nicht sachbezogen inspiziert und interpretiert, sondern moralisch disqualifiziert. WELT: Sie haben das in Ihrem Buch so ausgedrückt, das Verhältnis zu ihrer Geschichte sei den Deutschen nicht abhanden gekommen, sondern es sei ihnen ausgetrieben worden. DIWALD: So ist es. Sie wurde ihnen weggenommen. Ich erinnere» nur daran, daß man eine große Linie des angeblichen zwangsläufigen deutschen Unheils konstruierte, die man dann von Martin Luther über Friedrich II. und Bismarck bis hin zu Hitler gezogen hat. Schon während des Krieges erschien in den alliierten Ländern eine Fülle von einschlägigen Büchern, mit denen man dann auch nach 1945 in Deutschland das Geschichtsbild prägte. Vielfach ging man sogar noch hinter Luther zurück und behauptete, schon die staufischen Kaiser hätten nichts anderes betrieben als die Eroberung der Welt und die Unterdrückung anderer Völker. Wenn ein Volk seine ganze Geschichte derart in die Ecke gedrängt sieht und nur noch mit moralisch negativen und abqualifizierenden Vorzeichen kennenlernt, dann kann es doch gar kein positives Verhältnis mehr zu dieser Geschichte finden, zumal, wenn dieser Kriminalisierungsprozeß schon in den Schulen beginnt. WELT: Aber hat nicht der letzte Abschnitt der deutschen Geschichte so manchen Vorwand dafür geliefert? DIWALD: Während des Krieges wurden von der nationalsozialistischen Führungsgruppe grauenhafte Verbrechen begangen. Unsere Schuld wurde von uns niemals beschönigt. Sie wurde oft genug im vollen Umfang eingestanden. Viel zu oft; denn dank der überschießenden Häufung unserer Nationalbeichten wurde die Kollektivschuld-These ständig weiter gefüttert. Schuld ist eine sittlich-religiöse Kategorie. Die Vorstellung aber, daß ein ganzes Volk für kriminelle Taten verantwortlich sei, gehört in die Bezirke von Magie, Phantasie und moralischer Spekulation. WELT: Also auch unter Anerkennung der kriminellen Aspekte des Dritten Reiches dürfen sich die Deutschen nicht ihre ganze Geschichte kriminalisieren lassen? DIWALD: Die Ungeheuerlichkeit der Umerziehung bestand darin, daß man das, was man in der jüngsten deutschen Geschichte als das „institutionalisierte Verbrechen“ bezeichnen könnte, sozusagen zum logischen Zielpunkt der deutschen Geschichte verfälschte. So, als würde die deutsche Geschichte darin gipfeln und sein reinster Ausdruck sein. Welcher gesunde Mensch hätte da noch ein Interesse daran, sich mit einer solchen Geschichte zu befassen, zumal die negative Darstellung auch noch staatlich sanktioniert worden ist. Vor allem die nüchterne Deutung unserer Zeitgeschichte leidet unter dieser Moralisierung. WELT: Sie selbst sind der Auffassung, daß wesentliche Komplexe der Zeitgeschichte noch keineswegs so abschließend aufgehellt sind, wie man allgemein behauptet. Selbst bei der Judenfrage, so schreiben Sie, sei „trotz aller Literatur noch immer einiges ungeklärt“'. DIWALD: Mit vielem, was bis heute dazu publiziert und wie es dargestellt worden ist, können wir uns nicht zufriedengeben. Wir werden noch ganze Komplexe umschreiben müssen. Entscheidend ist dabei die Dokumentenfrage. Daß ein Hauptteil der zeitgenössischen Akten uns überhaupt noch nicht zugänglich gemacht worden ist, ist noch für viele Überraschungen gut. Die Russen haben kein einziges Dokument herausgerückt; die Franzosen halten ebenfalls ihre Archive und das, was sie bei uns mitgenommen haben, verschlossen. Die Amerikaner wählen bei dem, was sie uns zurückgeben, sehr vorsichtig aus. So stehen wir immer noch unter einer merkwürdigen Bevormundung. WELT: Über die Zeit nach 1945 fällen Sie Urteile, die Ihnen nicht nur Freunde machen werden. Warum machen Sie für die Spaltung Deutschlands vor allem die Alliierten, auch die Amerikaner, verantwortlich? DIWALD: Dieser Punkt steht heute doch schon jenseits aller Diskussion. Wesen und Gestalt Deutschlands seit 1945 gehören einwandfrei zu der Hypothek der Konferenz der Großen Drei von Jalta. Die deutsche Teilung wird von Ost und West in unerschütterlicher Ausdauer als Hypothek des Nationalsozialismus den Deutschen pausenlos vorgehalten. Es war aber Roosevelt, der mit seiner Zuneigung zu „Old Joe“ Stalin und in einem Illusionismus welthistorischen Formats Europa verspielte. Die Amerikaner sind bei der Beurteilung der Rolle, die sie im Zusammenhang mit der Konferenz von Jalta gespielt haben, übrigens schon weiter als wir. Sie haben schon lange die Freiheit des Urteils wahrgenommen, ihre eigene Rolle nicht mehr so sonnig zu sehen wie von 1945 bis zum Ausbruch des Kalten Krieges. WELT: Und die Verantwortung der Deutschen und Hitlers? DIWALD: Alle Entscheidungen der nach 1945 entstandenen Blöcke in Europa, seit Jalta festgefügt, und all die Entscheidungen deutscher Nachkriegspolitiker nur als unentrinnbare Folge von Hitler zu sehen – das ist ein bißchen simpel! Was für ein Alibi, immer nur sagen zu können, alle getroffenen Entscheidungen der Nachkriegszeit seien praktisch vorprogrammiert, einfach deswegen, weil Hitler einen Krieg vom Zaun gebrochen und ungeheure Verbrechen begangen habe! Damit würde man doch alle Staatsmänner und jeden Politiker von der eigenen Verantwortung für seine weit- oder deutschlandpolitischen Entscheidungen entlasten. WELT: Sie meinen, der Sündenbock darf niemals mehr große Sprünge machen? DIWALD: Genau. Wir entscheiden durch diese Sündenbock-Theorie nicht mehr so souverän, wie wir eigentlich dürften. Wir sind mit dem Kopf wie in einer Reuse gefangen. Hineinstecken hat man uns können. Aber wir kommen nicht ebenso glatt wieder heraus wie hinein. Den Kopf wieder freizubekommen geht nur, wenn man mit Vehemenz die Reuse zerstört. Daß dies nicht ohne Schmerzen abgeht, versteht sich von selbst. WELT: Ihre Darstellung der Nachkriegsgeschichte ist, wie Ihnen ein Rezensent nachgesagt hat, von grausamer Nüchternheit. So sehen Sie beispielsweise Adenauers einzigartige Größe, aber sie nehmen ihm übel, er habe die Einheit sehenden Auges verspielt. DIWALD: Die Beurteilung der Politik Adenauers im gesamten Kontext der Geschichte des 20. Jahrhunderts wäre ein Kapitel für sich. Was aber die Fräse der deutschen Einheit angeht, müssen wir ihm zwar konzedieren, daß er als Staatsmann zutiefst davon überzeugt war, sein Entscheid sei richtig. Aber wir müssen feststellen, daß es kein Entscheid war, der die Notwendigkeiten des ganzen deutschen Volkes als oberstes Ziel seiner Politik angesehen hat. Wenn in der Präambel des Grundgesetzes steht, das Hauptziel deutscher Politik bestehe in der Wiederherstellung der deutschen Einheit, dann war die Deutschlandpolitik Adenauers dieser Forderung jedenfalls nicht entsprechend. WELT: War diese Politik Adenauers nicht auch Ausdruck des klassischen deutschen Problems, entweder wie unter Bismarck und Stresemann das Risiko einer Politik zwischen den Mächten zu tragen oder mit der eindeutigen Entscheidung für den Westen oder den Osten auf „Nummer Sicher“ zu gehen? DIWALD: Es gibt überhaupt nirgends in der Politik und in der Geschichte ein „Nummer Sicher“, schon gar nicht für Deutschland mit seiner merkwürdigen Lage in Mitteleuropa und seiner territorialen Offenheit nach allen Seiten. Kein Vertrag, keine Koalition ist eine Garantie für Sicherheit. Politik ist Risiko und nicht Sicherheit – und Mut zum Risiko. Zur Politik gehört zwar das Voraussehen, soweit dies möglich ist, aber Sicherheit, ich möchte das wiederholen, gibt es nicht. Das ist eine dumme Vorstellung. WELT: Waren denn die Verhältnisse der Nachkriegszeit so, daß deutsche Regierungen überhaupt frei entscheiden konnten? DIWALD: Jede deutsche Regierung der Nachkriegszeit fand Zwänge vor, die sie nicht frei entscheiden ließen. Man muß das sehen, man darf es diesen Regierungen jedoch nicht zugute halten. Denn neben den Zwängen gab es auch deutsche Freiheiten. Das war den Politikern der Gründerzeit der Bundesrepublik auch bewußt. In ihren Diskussionen haben sie klar zum Ausdruck gebracht, wie elementar die Entscheidungen waren, die sie zu fällen hatten. Die West-Option Adenauers war keineswegs nur aufgenötigt, sondern sie war auch freiwillig ergriffen. WELT: Sie unterteilen selbst die Geschichte der Bundesrepublik in drei Phasen: die Regierungen der CDU, der Großen Koalition und schließlich der sozial-liberalen Koalition. Sehen Sie in einer dieser Phasen den ernsthaften Versuch, an die geschichtliche Kontinuität Gesamtdeutschlands anzuknüpfen? DIWALD: Alle Nachkriegsregierungen hatten eine deutschlandpolitische Konzeption. Bewerten aber müssen wir sie nach dem, was sie von ihren Konzeptionen realisieren konnten. Wenn Adenauer beispielsweise sagte, man könne sich der Wiedervereinigung nur mit Hilfe der West-Option und der Politik der Stärke nähern, dann hat er sein Ziel nicht erreicht. Mit dem Mauerbau vom 13. August 1961 war diese Konzeption endgültig gescheitert. Auch die sozialliberale Koalition muß sich fragen, ob ihre Realpolitik der unbekümmerten Vereinfachung das gebracht hat, was man sich von der Konzeption versprach. WELT: Man hat Ihnen schon vorgeworfen, Sie hätten mit Ihrer Arbeit ein nationales Lehrstück verfaßt und Sie würden nationale Empörung wachrufen wollen. Stört Sie das? DIWALD: Selbst wenn der Vorwurf in dieser vereinfachten Form richtig wäre, würde er mich nicht stören. Ich habe nichts anderes getan, als ein Dritteljahrhundert nach der größten Katastrophe, die die Deutschen bisher, betroffen hat, eine nüchternere, eine sachlichere und sogar eine leidenschaftslosere Betrachtung ihrer tausendjährigen Geschichte zu geben. Nichts anderes. Das ist seit 1945 nicht mehr von einem Fachhistoriker unternommen worden. Es hat auch noch keiner die Entschiedenheit aufgebracht, die Gemeinsamkeiten der Deutschen unabhängig von den Höhen und Tiefen der Geschichte zu überprüfen und noch einmal neu festzustellen. WELT: Es geht Ihnen um einen Identitätsbeweis der Deutschen. Worin sehen Sie neben dem Band der gemeinsamen Sprache und Kultur die Konstanten, die uns über die Epochen und über alle Grenzen hinweg verbinden? DIWALD: Wir haben eine so große Fülle von Konstanten, die uns auch heute berechtigen, nicht nur von den Bürgern der Bundesrepublik, der DDR und Österreichs, sondern ganz einfach von den Deutschen zu sprechen. Auch bei Erhellung bleibender Gemeinsamkeiten muß man die Klischees der Umerziehung zurechtrücken. Charakteristisch für uns nämlich ist, daß wir durchaus kein Volk von Untertanen sind. Wir sind vielmehr wohl das rebellischste Volk in ganz Europa gewesen. Die ganze Reichsgeschichte ist eine Geschichte der Aufsässigkeit. Denken Sie nur an das Verhältnis der Einzelstaaten und der Fürsten zu ihrem Oberhaupt, dem Kaiser, an die ständigen Gegensätze von Territorialegoismus und Stammesstolz, von Reichstreue und Regionalpatriotismus. Diese Unruhe ist ein Merkmal der eigensinnigen Kraft der Deutschen. Eine Manifestation ihrer Geschichte. WELT: Und trotzdem sprechen Sie von dem einen Volk der Deutschen? DIWALD: Hier sehe ich den zweiten roten Faden, der unsere Geschichte durchzieht: Wir haben zwar oft genug gegeneinander gestritten und gekämpft, gleichwohl kamen wir niemals voneinander los und haben immer wieder erneut den Anlauf gemacht, uns als Volk in einem einzigen staatlichen Verbund zu verwirklichen. Das gilt natürlich für das erste, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Das gilt auch für das nationalstaatliche Bismarck-Reich, bei dem die Österreicher draußen bleiben mußten. Sie haben trotzdem das Werden des deutschen Nationalstaats mit einem Gefühl des Irredentismus, des Unerlöstseins, begleitet. Und das gilt natürlich auch für das Dritte Reich und die Zeit nach 1945. WELT: Gibt es für den Historiker auch so etwas wie einen unveräußerlichen Nationalcharakter bei den Deutschen? DIWALD: Ich will mich auf das Feld der Völkerpsychologie nicht begeben, aber jedenfalls liegt eine weitere Konstante der Deutschen in bestimmten ihrer Eigenschaften, die sich immer wiederholen. Dazu zählt ein gewisses Potential an Bemühungen, über die politischen Realitäten in den geistigen Bereich auszugreifen. Das hat im deutschen Idealismus seinen Ausdruck gefunden, aber genauso bei Luther mit seiner Kritik an der Kirche, und es hat sich schließlich in der Romantik einen weiteren, besonders charakteristisch deutschen Ausdruck verschafft. Auch Im 20. Jahrhundert gibt es etwas Ähnliches, das sich vor allem in einer Suche „nach den Gründen“ niedergeschlagen hat, auch in sehr intensiven Selbstbefragungen im Zusammenhang mit zwei verlorenen Kriegen. WELT: Also sehen Sie keine Gefahr, daß die Motorik der deutschen Geschichte, wie oft vorhergesagt, zum Stillstand kommt? DIWALD: Ganz im Gegenteil. Wenn wir ein Fazit ziehen können, dann dieses: So viele oft blutige Kämpfe die Deutschen gegeneinander geführt haben, so viele Spaltungen sie haben hinnehmen müssen, das Gefühl der Gemeinsamkeit und der Zusammengehörigkeit ist bei ihnen bis heute nicht erloschen. Und das hat seit der Gründung des Deutschen Reiches 919 bis heute, immerhin über tausend Jahre, getragen.“
„Die grauenhaftesten Verbrechen unserer Geschichte“, in: Die Welt, 18.12.1978. Auch erschienen als Sonderdruck des Propyläen – Verlags unter dem Titel: „Geschichte im Widerstreit – Hellmut Diwald antwortet seinen Kritikern“ „Die grauenhaftesten Verbrechen unserer Geschichte“ „Diese beiden Seiten in der ‚Geschichte der Deutschen’ sind das Ungeheuerlichste, was ich seit 1945 habe lesen müssen“, sagte ‚Golo Mann. Gemeint war die „Geschichte der Deutschen“ (Propyläen Verlag)von Hellmut Diwald. Golo Mann kritisierte besonders die Seiten 164 und 165, die „Alt- und Neu-Nazis mit Freude einschlürfen werden“, weil „dieser Ordinarius einer, ja leider, bayerischen ‚Universität den Judenmord glatt ableugnet.“ Außer Mann hatten Publizisten der verschiedensten politischen Richtungen den Eindruck, daß Diwald mit seiner anti-chronologischen Betrachtung der deutschen Geschichte Nazi-Verbrechen zu bagatellisieren versucht. Zu diesen Vorwürfen nimmt Diwald in dem folgenden Artikel Stellung.(Die Welt) „Die grauenhaftesten Verbrechen unserer Geschichte“ von Hellmut Diwald. Seit 1945 stand die Geschichte der Bundesrepublik in Mißkredit. Ich habe, nachdem die größte Katastrophe Deutschlands nunmehr ein Dritteljahrhundert zurückliegt, versucht, unsere Beziehungen zu Tausend Jahren deutscher Historie neu zu bestimmen. Dabei bin ich von einem anderen Geschichtsverhältnis ausgegangen, als es traditionell üblich ist, nämlich von der unmittelbaren Betroffenheit, der direkten Erfahrung von Geschichte in unserer Gegenwart, dem politischen und gesellschaftlichen Alltag des Jahres 1978. Ich habe keine Trennung zwischen Geschichte und Gegenwartsgeschichte akzeptiert und damit eine alteingebürgerte historiographische Sperrzone durchbrochen. Ein solches Verfahren ruft die Zeitgenossen anders auf den Plan, als es bei sogenannten normalen Geschichtswerken der Falls ist. Jeder von uns ist Miterlebender, ob Zuschauer oder Akteur. Er fällt bei den Wahlen politische Entscheidungen, erklärt sich für dieses oder jenes Parteikonzept, die Regierungen sind von seiner Vertrauenserklärung getragen. Weil nun die politischen Verhältnisse unserer Gegenwartsjahrzehnte auf Engste mit 1945, dem Jahr der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands, und damit auch mit der Ära des Nationalsozialismus verkettet sind, rührt eine Geschichtsdarstellung, die sich um Nüchternheit, um differenzierte Einsichten und Interpretationen bemüht, beim Leser an emotionale Persönlichkeitsbezirke, ebenso an einen Bereich der Zwiespältigkeit, die den deutschen Sachen der Gegenwart eigentümlich ist. Das haben die ersten Reaktionen auf meine Geschichte der Deutschen gezeigt. Das Stigma der Deutschen heißt „Auschwitz“. Aber trotz dieses Faktums unfaßlicher Grausamkeit – vielmehr: Gerade wegen dieses Faktums darf Geschichtsschreibung nicht zu einem Dienstleistungsunternehmen zur Verbreitung größtmöglichen Wohlbehagens degradiert werden. Ich habe in meinem Buch den Versuch der nationalsozialistischen Führungsspitzen, ihren weltanschaulichen Rassenantisemitismus bis zur gänzlichen Vernichtung der Juden innerhalb des deutschen Einflußbereiches in Europa voranzutreiben, so dargestellt, wie es mir im Gesamtzusammenhang der Geschichte der Deutschen notwendig schien. Ich habe mich bemüht, es nicht nur in den gängigen Bekundungen des Abscheus zu belassen, sondern war bestrebt, auch die unterschiedlichen Interessen und Strömungen innerhalb der SS im Rahmen der Kriegsnotwendigkeiten anzudeuten, ebenso einiges von der Aufteilung der Kompetenzen im NS-Gefüge oder den Gruppengegensätzen. Schließlich habe ich den Satz geschrieben: „Was sich (seit Mitte 1940 mit dem Plan der Endlösung) in den folgenden Jahren abgespielt hat, ist trotz alle Literatur in zentralen Fragen noch immer ungeklärt.“ Über einige sehr polemische journalistische Attacken wäre ich um so leichter hinweggegangen, als ihre Autoren selber Funktionen in jenem SS-Regime eingenommen hatten, das ich nur als Kind erlebte. Aber diese ersten Stimmen stimulierten offenbar auch Kritiker und Kollegen, deren Urteil ich ernst nehme. Solche Mißverständnisse auszuräumen erscheint mir tatsächlich von allergrößter Wichtigkeit. Ich nehme das so ernst, daß ich im Text der schon geplanten nächsten Auflage meines Buches einige wegen der – mich höchst überraschenden – Mißdeutungen anscheinend notwendige Ergänzungen einfügen werde. Doch abgesehen davon, ob es sich um Mißverständnisse handelt, oder ob es bestimmte Motive für die publizistische Entrüstung gibt: In der Tat sind zentrale Fragen, die mit dem Schicksal der Juden während der Zeit des dritten Reiches zusammenhängen, noch ungeklärt.
Meine Position gegenüber der Gewaltherrschaft Hitlers scheint mir aus dem Buch so deutlich hervorzugehen, daß ich überhaupt nicht verstehe, wie man über folgenden Sätze hinweglesen konnte: „Während des Krieges wurden von der nationalsozialistischen Führungsgruppe an der Spitze die grauenhaftesten Verbrechen unserer Geschichte begangen. Millionen Menschen wurden ermordet im Namen Deutschlands und des deutschen Volkes. Was sie dazu veranlaßte, wie sie die Verbrechen begründeten, in welchem Zusammenhang sie mit der Kriegslage standen, alles das ändert nichts an der Tatsache selbst. Kein Deutscher wird dies bezweifeln.“ Ich habe ebenso geschrieben, daß „in den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten seit 1942 ungezählte Menschen ermordet wurden, Juden, Zigeuner, Homosexuelle, Menschen „minderen Erbgutes“ oder „Angehörige unterwertiger Rassen“. Ich habe ferner aus dem politischen Testament Hitlers vom April 1945 zitiert, das darin gipfelt, daß er das Judentum für den Krieg verantwortlich gemacht hat und dafür büßen ließ. Im Anschluß daran habe ich an die „Endlösung“ erinnert: „Dies ist das grauenhafteste Thema der systematischen Vernichtung eines Volkes, das für Ereignisse büßen mußte, für die es gemäß der Logik eines Wahnsystemes verantwortlich gemacht wurde – ein Thema, das durch die Vokabel „Auschwitz“ einen entsetzlichen Symbolwert erhalten hat.“ Wie konnte das alles mißverstanden werden? Aber nun zu einigen der ungeklärten Fragen, von denen ich in meinem Buch spreche. Nicht ohne Grund sind Diskussionen darüber in den letzten Jahren neu aufgeflammt. Ungeklärt ist die unmittelbare Urheberschaft des Plans der physischen Judenvernichtung: Wäre das anders, hätte es nicht zu so verwegenen Thesen wie jener von der Unkenntnis Hitlers von der Judenvernichtung kommen können. Ungeklärt sind die auslösenden Motive des Umschlags des ursprünglichen Konzepts einer forcierten Auswanderung der Juden über ihre gewaltsame Austreibung bis hin zu systematischen Ermordung eines ganzen Volkes. Ungeklärt ist, wann und in welchem Umfang die westlichen Alliierten und nichtdeutschen Regierungen Kenntnis von dem Schicksal erhielten, das die europäischen Juden drohte; ungeklärt sind die Motive ihres Schweigens, ihrer Reserve, ihrer Gleichgültigkeit; welchen Quellen also entsprang die „moralische Indolenz, mit der fast alle Welt bald darauf der Ausrottung der Juden zusah“, wie es ein namhafter deutscher Leitartikler anläßlich des Gedenkens am 9. November 1978 formuliert? Ungeklärt ist, wie es mit den verzweifelten Bitten an die im Besitz der totalen Luftherrschaft befindlichen Alliierten stand, durch Zerbombung der wichtigsten Bahnhöfe, Gleisanlagen und Vernichtungszentren die Deportation und den Genozid nachhaltig zu stoppen. Ungeklärt ist, warum die westlichen Alliierten 1943 den deutschen Vorschlag ablehnten, 70.000 Juden aus Bulgarien freizugeben; wir wissen nur, daß bei der Konferenz zwischen Roosevelt, Churchill und Eden in Washington der britische Außenminister zu bedenken gab: „Das europäische Judenproblem ist sehr schwierig, und wir sollten mit einer Offerte, die bulgarischen Juden aufzunehmen, sehr vorsichtig sein.“ Eden befürchtete, daß als Folge einer positiven Entscheidung Hitler vorschlagen werden, auch polnische und deutsche Juden aufzunehmen, und dies könnte dann nach einem Präzedenzfall nicht abgelehnt werden. Ungeklärt sind die Hintergründe des schauerlichen Projekts des von der SS 1944 vorgeschlagenen Tausches „Eine Million Juden gegen Lastwagen“; ungeklärt sind die Umstände, die zu der Frage Lord Moynes, des stellvertretenden britischen Staatsministers im Nahen Osten, gehörten: “Was soll ich mit dieser Million Juden tun?“ Ungeklärt sind die Gründe, warum der damalige stellvertretende Außenminister der Sowjetunion Andrej Wyschinski in einer Geheimmitteilung das Veto Moskaus gegen alle weiteren Verhandlungen der USA über das Projekt einlegte. All das, und überdies noch eine Fülle von Einzelheiten, wird solange ungeklärt bleiben, bis sich die jetzige Situation des Quellen- und Dokumentenbestandes ändert. Das ist jedem der etwas näher mit der Geschichte des Nationalsozialismus befaßt hat, bekannt. Sämtliche NS-Akten und ebenso die Quellen zur Geschichte der Weimarer Republik wurden 1945 von den Siegermächten beschlagnahmt, ein Teil davon wurde vernichtet. Die USA und Großbritannien begannen erst seit 1960, ausgewählte Bestände zurückzugeben. Die einschlägigen Dokumente in der DDR sind der westdeutschen Forschung unzugänglich. Der Modus, nach dem die USA die NS-Akten des Berliner „Dokument Center“ preisgeben oder zurückhalten, schwankt zwischen Geheimnis und Willkür. Die Sowjetunion und Frankreich haben bis heute noch keine einzige Akte zurückgegeben. Prüfung der Quellen zum Zweck zuverlässiger Information hat nicht das geringste mit der Relativierung des sittlichen Urteils zu tun. Schließt die unbestreitbare und von keinem ernst zu nehmenden Menschen bestrittene Ungeheuerlichkeit der Verbrechen Hitlers und seiner verantwortlichen Führerschicht eine sachliche Diskussion aller Umstände, die zu den Verbrechen gehören, aus? Schon daß man heute als Historiker gezwungen wird, eine solche Frage zustellen, ist absurd. Soll und kann das Ausmaß der Judenvernichtung zu einer Grenze erklärt werden, die wir selbst dann nicht berühren dürfen, wenn es um die weitestmögliche Klärung von Sachverhalten geht? Die freie Verfügbarkeit über das noch vorhandene Gros der NS-Akten wird geraume Zeit auf sich warten lassen. Nur der Griff zu den Quellen kann dem Historiker ein Optimum an Gewißheit vermitteln, auch dem Zeithistoriker. Unterschiedliche Darstellungen und Interpretationen von Sachverhalten lassen sich nicht anders diskutieren und klären als mit Hilfe der Quellen. Am kriminellen Charakter des Hitler-Regimes gibt es nichts zu bezweifeln, nichts zu beschönigen, nichts läßt sich relativieren: ich habe das seit Jahren immer wieder betont. Aber es gibt noch viel zu klären und zu differenzieren. Und es muß ohne Rücksicht darauf, wem dies behagt oder zuwider ist, die Frage untersucht werden, ob die Verbrechen des Nationalsozialismus das unausweichliche einer auf Herausbildung des Kriminellen angelegten Geschichte der Deutschen oder ob für diese Verbrechen die NS-Führungsschicht, ihre Helfer und die das Regime unterstützenden Massen verantwortlich waren. Deutschland ist bis 1933 für die Juden des europäischen Ostens ein Land der Hoffnung gewesen. Kein Volk in Europa, bei dem der jüdische Anteil im Geistigen, in Kultur und Wissenschaft, in Wirtschaft und Gesellschaft von vergleichbarem Gewicht gewesen wäre wie beim deutschen. Rassenantisemitismus war in diesem Deutschland ohne Bedeutung. Wohl aber gehörte der Rassenantisemitismus, die Rassenlehre, zentral zur Hitlerbewegung, war die Voraussetzung für die grauenhaften Verbrechen. Nach 1945 wurden all diese Verbrechen von den meisten Deutschen weder geleugnet noch beschönigt, sie lösten vielmehr über Jahre, Jahrzehnte hinweg mit Recht die abgründigste Gewissensqualen aus. Mit jenen unfaßlichen Verbrechen, zumal der systematischen Judenvernichtung hing die seinerzeit so leidenschaftlich erörterte These von der Kollektivschuld der Deutschen zusammen. Sie muß heute, da eine Hinwendung zu unserer Geschichte eingesetzt hat, zwangsläufig wiederum aufgerollt werden. Sind also die Verbrechen der Hitler-Ära nur von einem Teil der NS-Funktionäre begangen worden, oder ruht auf den Deutschen schlechthin – auf jedem Deutschen – eine kollektive Schuld dafür? Sei es, weil die Untaten im Namen Deutschlands begangen wurden, sei es, daß nicht nur Regierungen oder Politiker die Schuld für ihre kriminellen Taten zu tragen haben, sondern Völker selber. Oder gibt es zwar keine Kollektiv-Schuld, wohl aber eine kollektive Verantwortung und damit Haftung? In den Jahrzehnten nach 19445 stellte sich schließlich nach langem Ringen die Frage der Schuld in einer doppelten Form: Unter religiösen, theologischen, metaphysisch-ethischen Gesichtspunkten besaß die Kollektivschuld-These einen unbestreitbaren, in ihrer Dimension rational nicht auszulotenden Gehalt. Nicht halten ließ sie sich jedoch als politische Kollektivschuld, als eine Art säkularisierte Erbsünde, deren Makel selbst den Ungeborenen alle künftigen Geschlechter gewiß sei. In unserer Gegenwart des Jahres 1978 akzeptieren die Jüngeren weitgehend den moralischen Gehalt der Kollektivschuld-These. Die Ausweitung in den politischen Raum, samt den politischen Konsequenzen, lehnen sie zu Recht ab. Ihr Verhältnis zum Judentum, zu Israel, zu den jüdischen Mitbürgern, die freilich aufgrund ihrer geringen Zahl kaum ein beachtliches Element ihres gesellschaftlichen Alltags darstellen, ist von befreiender Unbefangenheit. Dies entspricht auch dem Freimut mit dem eine neue Generation der Geschichte der Deutschen gegenübersteht. Sei weiß, daß zu dieser Geschichte ungeheure Verbrechen gehören, daß sie sich jedoch darin nicht erschöpft. Ihre Aufmerksamkeit steht auf einer soliden Basis: dem Willem zur zuverlässigen Information. Die Jungen in unserem Lande halten nichts davon, Hitler – seine Bewegung sowenig wie seine Verbrechen – im Halbdunkel der Mystifikation des Schrecklichen zu lassen. Sie beharren nicht zuletzt deshalb auf präzisen Auskünften, weil sie die Unentbehrlichkeit ihrer Geschichte wieder entdeckt haben, samt ihrer Tiefen und ihren respektablen Zeiten, samt ihren unauslöschbaren Verbrechen, aber auch samt denjenigen Manifestationen, die es uns auch heute erlauben, im Vertrauen auf die tragende Substanz unserer Geschichte das Wort „deutsch“ auszusprechen.
Sprache im Niemandsland. Die Schwierigkeit, einander zu verstehen, in: Rheinischer Merkur. Sprache im Niemandsland Talleyrand hatte gemeint: „Die Sprache ist dem Menschen gegeben, um seine Gedanken zu verbergen." Solche Pointen zu zerdröseln, ist ein mißliches Geschäft. Die Absicht, es genau wissen zu wollen, ist zwar höchst ehrbar, leider aber auch ein wenig spießig. Trotzdem muß sich derjenige, der es mit der Sprache genau nehmen will, gegen die Anfechtungen des Doppelsinns, der Andeutung, der Wortspiele wehren, muß auf klare Information drängen und das Fehlen von Logik brandmarken. Wenn Picasso augenzwinkert: „Kunst ist eine Lüge, welche die Wahrheit sichtbar macht", so läßt sich das ohne viel Mühe verstehen. Sobald aber Erich Kästner behauptet „Wenn ich die Wahrheit sagen wollte, müßte ich lügen" — 'steigt dem Buchhalter der korrekten Aussagen die Magensäure hoch. Die normale Reaktion wäre: „Das verstehe ich nicht" Ein offenes, naturwüchsiges Wort stramm genug, um gegen den kleinen Hohn des Gegenübers über soviel literarische Asphaltferne gefeit zu sein. Die Ironie braucht ihn nicht zu interessieren. Er hat mächtige Bundesgenossen, an erster Stelle die gigantischen Wortführer der Informatik. Sie und die vielen Nebenerwerbsbetriebe des Neopositivismus leben von der Voraussetzung eines logischen Rasters, das für alles und jedes gilt Wenn ich „zwei und zwei" sage, weiß jeder, was ich meine. Wer so schreibt, also gemäß arithmetischer Präzision, wird so verstanden, wie es auf den Zeilen steht. Das „Zwischen – den – Zeilen – lesen – Wollen" wirkt demgegenüber wie abgewelkter Surrealismus. Es ist sinnlos, denn zwischen den Zeilen steht nichts. Andererseits hat uns der vielberufene, vielgeschmähte Historismus gelehrt daß zu den gesellschaftlichen und politischen, kulturellen und religiösen Bereichen eigene Maßstäbe gehören. Deshalb hat jede Epoche einen unbezweifelbaren Anspruch darauf, an denjenigen Normen gemessen zu werden, die sie selbst als gültig angesehen hat. Der Irrtum, das Mißverständnis, ja die Verlogenheit beginnt dort, wo Maßstäbe aus dem Bereich, für den sie gültig sind, herausgelöst und für einen anderen als verbindlich erklärt werden; also etwa gesellschaftliche Normen auf Künstlerisches auszudehnen. Das Mißverständnis verwandelt sich dann prompt in ein Verdikt Dieses Risiko ist kaum weniger peinlich als jenes, das André Gide befürchtete, als er einen Gesprächspartner warnte: „Verstehen Sie mich bitte nicht zu schnell." Aus der Geschichte sind uns Gesellschaften bekannt, deren Konventionen und Standards ein Ausdruck der gesellschaftlichen Übereinstimmung waren. Erziehung konnte sich dabei auf den Unterricht des Schicklichen verdichten: „Das und das gehört sich nicht!" Nur so extravagante Jugendliche, die heute in den Verdacht gerieten, Aussteiger zu sein, hatten den Mut zu fragen: „Warum gehört sich das nicht?" Das ist jetzt anders. Einerseits ist unsere hochentwickelte Gesellschaft in aller logischen Brutalität auf nachprüfbare, harte Leistung ausgerichtet. Andererseits ist dieselbe straff durchgliederte Gesellschaft in den Gefilden dessen, „was sich gehört", so rückgratlos wie ein Regenwurm, so permissiv und verwaschen unter der lappigen -Flagge „liberal", daß ein Mann wie der für Freiheit kämpfende polnische „Solidaritäts-" –Chef Lech Walesa für die Parteiendemokratie westlichen Musters nur Hohn übrig hat: „Für mich sieht das wie ein Bordell aus und sonst nichts. Hier in Polen könnten wir keine politischen Parteien brauchen." Wie denn? Verstehen wir die Motive der polnischen Reformer? Verstehen sie uns und unsere schwierige Demokratie mit ihrer so entschiedenen Orientierung auf den Menschen und den Schutz seiner Würde und Freiheit? Und noch wichtiger: Verstehen wir uns selber untereinander? Unsere politischen Parteien suchen seit Jahr und Tag, wie die Offiziellen versichern, den „Dialog mit der Jugend". Schon die Formulierung zeigt daß hier von keinem Dialog die Rede sein kann, nur von einem Aneinandervorbeireden. Das hat nichts mit dem saisonal aufgewärmten Generationskonflikt zu tun. Es hat etwas mit der unterschiedlichen Sprache der Alten, Älteren, Jüngeren und Jungen zu tun und dem Niemandsland zwischen Information und Kommunikation, das von den schauderhaften Barrieren der Sprachlosigkeit durchzogen ist. Deshalb, nur deshalb verstehen sie sich nicht. Die Älteren haben im politischen Alltag ihre Ernüchterungen hinter sich gebracht. Sie haben gelernt, daß man mit dem Gepäck von Pfadfindertugenden allein nicht durchkommt. Wenn sie Format haben, führen sie den Rest ihrer Überzeugungen nicht wie einen Schäferhund neben sich. Es ist kein Zeichen ausgeprägter Intelligenz, allzusehr von irgend etwas überzeugt zu sein. Aber es ist ein Zeichen von intakter Moral. Das sollte um so höher zu schätzen sein, als Heute an Intelligenz kein Mangel besteht. Die Sprachlosigkeit zwischen den Gruppen und Gruppierungen, zwischen den Aberhunderten von Bürgerinitiativen und den etablierten Parteien, die Unfähigkeit, einander zu verstehen, geht zu einem Gutteil auf das Fehlen einer gemeinsamen Basis zurück, die unseren Pluralismus trägt Schlüsselworte wie Freiheit, Friede, Selbstbestimmung, soziale Gerechtigkeit, Imperialismus oder Menschenwürde sind Floskeln geworden, deren Handhabung jedem freisteht und die im Osten genauso gängig sind wie im Westen, in der Dritten Welt genauso wie in der Vierten. Jeder versteht etwas anderes darunter. In den Vereinigten Staaten wird der Freiheitsbegriff extensiv persönlich ausgelegt. So darf aufgrund der Verfassung kein Schüler gezwungen werden, etwas zu lesen, das er nicht lesen will. Das entschied kürzlich ein amerikanisches Gericht Was bedeutet diese Art Freiheit den vielen Millionen, die nie Gelegenheit erhalten, überhaupt lesen zu lernen? Solche Ungereimtheiten gehören zum täglichen Brot des eindrucksvollen Weltforums der UN, zu dem sich die Nationen vereint haben, um miteinander zu reden. Tatsächlich reden sie seit ihrer Gründung aneinander vorbei; es ist schwer zu entscheiden, ob ihre unverdrossene Geduld ein Zeichen der Zuversicht ist oder der Erschöpfung. Zwischen den Menschen, die durch Normen bestimmt sind, die sich gegenseitig ausschließen, ist kein Dialog möglich. Das macht die Szene der Bürgerinitiativen und Grünen, der Plünderideologen, Hausbesetzer und Wanderer in den alternativen Zwischenwelten so verfahren. Man könnte, immerhin versuchen, die Interessen an Sachfragen zu binden — ein Minimum an Willen zur Gemeinsamkeit vorausgesetzt Also gemeinsam herauszufinden, was an strittigen Punkten wahr und falsch ist und dabei Wahrheit in dem bieder-klassischen Sinn zu verstehen als das simple Zusammentreffen der Ansicht mit der Sache. Ein solches Gespräch miteinander verliefe zunächst als Argumentieren. Das Verständnis würde sich zwar erst in der zutreffenden Antwort zeigen, aber beginnen würde es mit der Bereitschaft, zuhören zu können. Darauf baute das Vertrauen von Konfuzius vor zweieinhalbtausend Jahren als er auf die Frage, wie mit der Verbesserung des Staates zu beginnen sei, antwortete: Zuerst müsse dafür gesorgt werden, „daß alle Dinge mit ihrem rechten Namen, genannt werden. Wenn die Sprache nicht stimmt, dann ist das, was gesagt wird, nicht das, was gemeint ist. Ist das, was gesagt wird, nicht das, was gemeint ist, so kommen keine guten Werke zustande. Kommen keine guten Werke zustande, so gibt es weder Kunst noch Moral..." Und dann wisse das Volk schließlich nicht mehr, wo es den Fuß hinsetzen und wo es anlegen solle.
Was Würzburgs steinerner Löwe die Historiker lehren kann, in: Die Welt, 26.02.1983, auch erschienen als erstes Kapitel „Der Löwe am Stein“ im Buch „Mut zu Geschichte“. Was Würzburgs steinerner Löwe die Historiker lehren kann Die breite Asphaltstraße von Würzburg nach Veitshöchheim wird nur selten von Fußgängern benutzt. Der Autostrom reißt kaum ab, Spaziergänger werden durch den dichten Verkehr an den steil abfallenden Fuß des Steinbergs gedrängt. Zu Beginn unseres Jahrhunderts ließ Prinzregent Luitpold von Bayern die Straße bauen; zugleich wurde eine Begradigung des Steinbergs durchgeführt. Zur Erinnerung an dieses bemerkenswerte Ereignis wurde am höchsten Punkt der Veitshöchheimer Straße ein ansehnliches Denkmal geschaffen: der „Löwe am Stein“. In einer Nische des Berges reckt sich das bayerische Wappentier, ein mächtiger Löwe, mehr als lebensgroß, zottig, voll verhaltener Kraft, die rechte Vorderpfote nach vorn gestemmt, den Blick auf Würzburg gerichtet, die linke Tatze fest auf dem Wappenschild des Landes und die Augen voller Sommerglut, angesammelt - so darf man vermuten - zum Schutz gegen das Eis anderer Zeiten und deshalb trotz der Härte von unbedingter Sachlichkeit. Der Weinstock im Hintergrund des Reliefs bindet das Denkmal unmittelbar in die Reben des Steinbergs ein. Die umlaufende knappe Inschrift hält fest, daß die Straße unter der Regentschaft Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen Luitpold von Bayern, im Jahre 1902 erbaut und das Monument „im Stein ausgeführt" wurde. Alte Würzburger wissen aus den Erzählungen ihrer Eltern, daß die Vollendung der Straße und die Weinbergskorrektion am 15. Juni 1902 im Hofgarten des Veitshöchheimer Schlosses mit einem gewaltigen Fest gefeiert wurde. Die steinige Bodenformation hat dem Berg im Norden Würzburgs seinen Namen gegeben. Der „Stein“ ist vermutlich der älteste Lagename eines Weinbergs, mit seiner Hektarzahl von 110 eine der größten geschlossenen Weinlagen Deutschlands. Der Steinwein wird zu den feurigsten unter den Frankenweinen gezählt. Deshalb kennt auch jeder Würzburger den „Löwen am Stein“, und darum beachtet ihn kaum jemand, wenn er daran vorbeifährt. Beträchtlich vertrauter sind ihm die Kelterprodukte der Reben am Stein. Seit vielen Jahrhunderten hält hier die _Kunst der alkoholischen Gärung von Weintrauben und das Ritual des durchgeistenden Zechens beharrlich Schritt mit der Formung des Charakters und sichert das Fundament der löwengleichen Herrschaft des Bocksbeutels. Dem Löwen am Stein ist dieses mainfränkisch bewirkte Desinteresse an seinem, Dasein genauso gleichgültig wie die individuelle Aufmerksamkeit, die er nur noch selten weckt. Unerschütterlich gelassen blickt er in Richtung Stadt. Seine Natur – sowohl die animalische als auch die skulpturell – heraldische – läßt ihm keine andere Möglichkeit. Diese Ruhe ist allerdings trotz der Bedingungen, von denen sie abhängt, auch der vollkommene Ausdruck einer Distanzierung, die in ähnlicher Form für den Blick in die Geschichte wesentlich ist – oder doch wesentlich sein sollte. Auch der Historiker, der wie jeder andere dem Wechsel der Tage und Wochen, ihren Ereignissen, Widerwärtigkeiten und Hochgefühlen ausgesetzt ist, muß ständig versuchen, den Blick distanziert über die Zeiten zu richten. Ob er dazu begabt ist, ob er ihn mühsam erlernen muß oder ob er zeitlebens nur die Haltung des Überblicks imitiert: Unbestechlich wird dadurch markiert, inwieweit er den Abstand zwischen Fiktion und geschichtlicher Wirklichkeit verringern kann. Der Löwe am Stein gehört nicht zu den berühmten Denkmälern. Wer ihn aber mit dem sanften Respekt des Augenmenschen vor Einzelheiten betrachtet, spürt überraschend, wie intensiv sich das Leben mit der Geschichte vermischt. Monumente dieser Art errichtet man nicht, um die Loslösung einer Idee aus den Klauen des Alltags zu symbolisieren. Die Erinnerung an ein bestimmtes Ereignis sollte wachbleiben – das war die Absicht, und deshalb ist der Löwe am Stein im Lauf der Jahre viel zu innig mit dem Weinberg verwachsen, als daß er sich nur als ein Standbild zur Stärkung der Würde des Wittelsbacher Herrscherhauses deuten ließe. Das gibt ihm seine Besonderheit. Die Einbindung in das Tagewerk der Winzer und Hacker hebt die beziehungslos scheinende Starre, die ansonsten eine sakrosankte Üblichkeit historischer Erinnerungszeichen ist, nahezu völlig auf. So illustriert der Löwe am Stein in gehöriger Entsprechung ein Prinzip geschichtlicher Arbeit: den Gegensatz zwischen aktiver Lebendigkeit und scheinbarer Erstarrung der Zeugnisse, die erhalten geblieben sind, in der Darstellung aufzuheben. Wer sich mit Geschichte befaßt, ist ununterbrochen zum Über-Blicken gezwungen, ist zu einer Sicht genötigt, die sich von den aktuellen Zeitbedrängnissen freihält. Er muß Abläufe zusammenfassen, Entwicklungen gruppieren, Veränderungen aus dem Abstand der Einsicht deutlich machen. Das kann er nur mit Hilfe der anstößigen Verwegenheit, alles zu vergessen oder wenigstens in Frage zu stellen, was es an Vorwissen gibt - in den Sachen also keine altbackene Vielfalt erkennen, sondern sie so zu sehen, als hätte noch nie ein anderer sie gesehen. Das ist nicht einfach. Es setzt Entdeckerfreude auch dort voraus, wo es angeblich nichts mehr zu entdecken gibt. Es verlangt die Unbefangenheit, alle Menschen, Mächte und Motive der Geschichte so zu sehen, als wären sie nicht schon tausendmal gesehen, geschildert und gedeutet worden. Wer sich auf solche Weise mit der Geschichte beschäftigt, dem zeigt der, erste Blick ein wirres Durcheinander. In diesem Chaos hat er ein System zu finden, er muß sich darum bemühen, etwas von dem zu erkennen, „was die Welt im Innersten zusammenhält". Ein Historiker, der nicht voraussetzt, daß ein solcher Zusammenhang existiert, betreibt sein Geschäft wie ein Maler, der eine Leinwand ohne Rand mit dem Pinsel bedrängt. Natürlich entspricht die Wirklichkeit nur selten unserem Bedürfnis nach Gliederung. Aber im Unterschied zu den Impressionisten der Vergangenheit lebt die Aufmerksamkeit des realitätsnahen Geschichtsforschers von der Gewißheit, daß er zumindest mit Hilfe der Chronologie in der endlosen Flut früherer Zeiten die Strömung wiederfindet, deren Richtung scheinbar verlorengegangen ist. Die gefährlichste Klippe dabei ist unsere eigene Erwartung: Unser Denken und Schließen hält sich an eine Ordnungsfolge. Dementsprechend versuchen wir hartnäckig, eine Art historischer Logik zu entdecken, und weigern uns zuzugeben, daß wir in der Vergangenheit weit häufiger Elemente des Absurden finden als Bausteine für die Pavillons und Kristallpaläste auf der Weltausstellung unserer eigenen Verklärung. Deshalb gehört es zu den Grundbedingungen einer real geschichtlichen Forschung, sich prinzipiell durch nichts beeindrucken oder gar verwirren zu lassen. Das Verblüffende ist für den Historiker etwas Normales. Das Risiko, dabei in einer Sintflut der Begriffe unterzugehen, ist nicht groß. Auch die heftigste unserer Emotionen verläuft innerhalb der gängigen Bezugsmöglichkeiten auf vergleichbare Erfahrungen. Dieser Trost liegt in dem uralten Wort des Predigers Salomo, daß nichts Neues unter der Sonne geschieht. Weil aber niemand alles erfahren kann, kommt es so sehr auf die Vitalität der Einbildungskraft, die Stärke der Phantasie an. Der Historiker muß denselben Fundus der Eingebungen besitzen wie ein Romancier oder Lyriker - aber er darf nur das verwerten, was ihm die Realität erlaubt. Fiktiver Tatbestand und historische Wirklichkeit gehören zum Erkenntnisprozeß. Geschichte schreiben heißt nicht zuletzt, ein Geschehen, das als Ganzes niemandem außer dem lieben Gott und den liebenswerten Phantasten zugänglich ist, in seinen Grundzügen zu rekonstruieren. Das gibt der Vorstellungskraft einen überragenden Stellenwert. An der unumstößlichen Tatsache der Einmaligkeit des geschichtlichen Gesamtprozesses ist genausowenig vorbeizukommen wie an der Singularität des Menschen. Die Merkmale, die er als Individuum und als Gattung hinterläßt, seine Dokumente, Quellen, Erinnerungszeichen wie zum Beispiel der Löwen am Stein, sind Indikatoren seiner herausgehobenen Situation. Deshalb garantiert die Art und Weise unserer Zeitvorstellung, also die Dimension der Zeit selbst mit Anfang und Ende der Welt und der irdischen Geschichte, die exklusive Stellung unseres Planeten und seiner Menschheit. Alle unsere Erfahrungsmuster beruhen auf der linearen Zeitvorstellung und der meßbaren Realzeit; zumindest gilt das in den christlichen, euro-atlantischen Bereichen. Und aus der Realzeit ergibt sich die Unumkehrbarkeit der Geschichte. Wenn man das System der bloßen Aufeinanderfolge in Raum und Zeit für sich nimmt, ist es voll mechanischer Sinnlosigkeit. Aber als Gliederungsprinzip wird es zur Voraussetzung dafür, daß der Mensch aus den Essentialen der Geschichtsforschung Schutz und Kraft gewinnt. Unser Bewußtsein braucht Zeitbarrieren, es benötigt Horizonte, um seine Fähigkeiten zu erproben, das Un-Begrenzte, ja Un-Endliche übersteigen zu können. Am Widerstand dieser Sperren entwickelt sich das Vertrauen des Menschen zu sich selbst – bei aller skeptischen Zurückhaltung, die als Grundton zu unseren Einsichten gehört; das ist uns heute, elf Jahrtausende nach Beginn der aufeinanderfolgenden Geschichte, stärker bewußt als in jeder früheren Epoche. Zu den Erfahrungen von der Grenze gehört allerdings auch die Erkenntnis, daß Zerstörung immer an den Rändern beginnt, intellektuell. Nur das Bewußtsein von Zeit und Geschichte, von Anfang und Ende kennzeichnet uns als Menschen. Ohne diese Tatsache gibt es keine Orientierung. Die Historiker haben sich seit Jahrhunderten mit allen Kräften darum bemüht, in den Bereichen, die der Mensch hinter sich gebracht hat, Pylone für den Ordnungswillen zu errichten. Solche Anstrengungen waren immer begleitet von dem Mißtrauen, das wir mit vielen guten Gründen aller menschlichen Gedankenarbeit entgegenbringen; unsere Bemühungen um die Wirklichkeit werden am stärksten gelähmt von dem Gespenst der eigenen Schwäche. Aber im Unterschied zu den Kostgängern unserer Geschichtskatastrophen, die sich nähren am Unbehagen an der eigenen Vergangenheit, weichen Realhistoriker dem Gesichtspunkt von Anfang und Ende nicht aus. Sie lassen sich von einem verbindlichen Optimismus beflügeln statt von zynischer Zuversicht, die so leicht ist und beliebt, weil alles für sie spricht. Wenn aber Anfang und Ende untrennbar zur Geschichte gehören, wenn auch das Ende der Welt selbst ein Teil der Geschichte ist, schließt sich ein Kreis. So gesehen, wird die lineare Zeitvorstellung des Historikers gleichbedeutend mit dem zyklischen Konzept des Daseins. Das macht Beweisführungen innerhalb von Zeitschleifen den traditionellen Erklärungsformen der Historiker gleichwertig. Klio, die alte Muse der Geschichte, ist im übrigen immer auch die Standartenträgerin einer Zukunft gewesen, deren Vision sich am stärksten der Wirklichkeit angenähert hat in der Sehnsucht nach den früheren Zeiten, den angeblich so goldenen Epochen der Vergangenheit. Schon Hesiod hat vor mehr als zweieinhalbtausend Jahren davon geträumt, und einige Jahrhunderte nach ihm ist es in Europa durch das Christentum zur Gewißheit geworden, daß der Anfang, das Paradies, in der Endzeit wiederkehrt. Historische Arbeit beginnt mit dem Sammeln von Informationen über einen Sachverhalt. Ohne diese Grundlage gibt es keine zuverlässige Urteilsbildung. Auch Eventualitäten und mögliche Hypothesen müssen sich auf Fakten stützen und nicht nur auf Mutmaßungen. Wir kennen das aus der Logik und Rechtsprechung, es ist bei jeder mittelbaren Beweisführung anhand von Indizien der Fall. Das gilt im übrigen auch für das Verfahren unserer Selbsteinschätzung. Die Auslegung unseres Selbstverständnisses ist von jeher ein Kernproblem gewesen. Sie hängt entscheidend ab von unserer Haltung dem Kommenden gegenüber. Es gibt keinen Zweifel daran, daß alle Zukunft sinnlos wird, wenn die Vergangenheit sinnlos ist. Die Sicherheit dieser Erkenntnis lebt von mehr als nur von der Annahme ihrer Gewißheit. Der Historiker kann sich nur selten den Luxus weitgespannter Überlegungen leisten. Die Bürde seiner Plackerei im Detail ist andererseits keine Entschuldigung dafür, daß es nicht seines Amtes wäre, sich regelmäßig Rechenschaft über sein Tun zu geben, zurückzublicken in der scheinbar kühlen Unbetroffenheit des Löwen am Stein. Er wird das nicht mit allgemeiner Sinngebung verwechseln. Sein Metier liefert ihm dafür keine Argumente oder Beweise. Geschichte lehrt ihn allenfalls einiges über die menschliche Unzulänglichkeit. Er findet in der Geschichte nicht „Sinn", aber er entwickelt Verständnis, auch für das vermeintlich Sinnlose. Immerhin schafft sich auch Ohnmacht ihre eigenen Privilegien, und sei es, wie im Fall des Historikers, das Vorrecht, die anspruchsvollen Fragen nach dem Woher und Wohin guten Gewissens den Philosophen zu überantworten. Dort sind sie besser aufgehoben, genausogut wie bei den Gottesgelehrten oder bei den Dichtern. Einer von ihnen hat sein Loblied auf Würzburg - vielleicht nach einem Blick auf den Löwen an der Straße nach Veitshöchheim - mit den erfreulich zuversichtlichen Zeilen beendet: „Um alles zu wissen / setz dich / auf die Kante des Steins / am Ufer des Mains / in Würzburg.“
Zum 8. Mai 1945, in: Witikobrief, Folge 3, April/Mai 1985. Zum 8. Mai 1945 Gedenktage sind Tage der Besinnung, der Erinnerung, der Bilanz. Der 40. Jahrestag der militärischen Kapitulation Deutschlands beschäftigt die bundesrepublikanischen Medien seit Monaten. Die Unverfrorenheit des Versuchs, uns den 8. Mai 1945 als Datum der Befreiung schmackhaft zu machen, wird nur durch die Schamlosigkeit der Begründungen dafür übertroffen. Der 8. Mai scheint des Schicksals sicher zu sein, im Öffentlichen ein Tag der Heuchelei zu werden. Am 8. Mai 1945 wurde in Europa der Krieg beendet. Wer diesen Tag mit Bewußtsein erlebt hat, wer sich an ihn erinnert ohne die Beschönigungen, Verzerrungen, Beflissenheiten und Lügen, mit denen seit Jahrzehnten unsere Geschichte und insbesondere unsere jüngere und jüngste Vergangenheit ungenießbar gemacht wird, der weiß es besser. Daran muß jeder von uns festhalten, ohne Konzessionen an das, was bequem ist, was gern gehört wird von denjenigen, die den politisch-offiziellen Beifall spenden. Opportunisten sind die Totengräber der deutschen Selbstbehauptung. Der 8. Mai 1945 war ein Tag des Elends, der Qual, der Trauer. Deutschland, das deutsche Volk hatten sechs Jahre lang im gewaltigsten Krieg aller Zeiten um die Existenz gekämpft. Die Tapferkeit und Opferbereitschaft der Soldaten, die Charakterstärke und Unerschütterlichkeit der Frauen und Männer im Bombenhagel des alliierten Luftterrors, die Tränen der Mütter, der Waisen, wer die Erinnerung daran zuschanden macht, lähmt unseren Willen zur Selbstbehauptung. Daran sollten wir am 8. Mai denken. Die Sieger von 1945 erklären, für die Rettung der Humanität einen Kreuzzug gegen Deutschland geführt und gewonnen zu haben. Geführt auch mit den Mitteln eines Bombenkrieges, der das Kind, die Frauen, die Flüchtenden, die Greise genauso als Feind behandelte wie den regulären Soldaten. Der Tag der militärischen Kapitulation der deutschen Armee brachte den Alliierten den Frieden. Abermillionen von Deutschen brachte er die Hölle auf Erden. Haben die Sieger von 1945 keinen Anlaß danach zu fragen, mit welchen Verbrechen sie dem Triumph ihres Kreuzzuges für die bedrohten Menschheitswerte das Siegel aufgedrückt haben? In jenen Friedensjahren nach der Kapitulation, in denen von Ostpreußen bis nach Jugoslawien Deutsche erschlagen, hingemetzelt, vergewaltigt, gefoltert, vertrieben wurden - in jenen Jahren, die man uns jetzt zumutet, als Zeit der Befreiung und Wiege einer Zukunft zu feiern, die uns zum ersten Mal in unserer tausendjährigen Geschichte „Freiheit, Recht und Menschenwürde“ gebracht haben soll? Denken wir daran am 8. Mai. Wer im 20. Jahrhundert einen Krieg verliert, wird vom Sieger zum Schuldigen und Verbrecher erklärt. Wie soll man das Wertesystem derjenigen einschätzen, die mit denselben Urteilskategorien dem deutschen Volk 1945 jede Moral und alle Rechte bestritten und wenige Jahre später, als deutsche Männer wieder als Soldaten gebraucht wurden, das deutsche Volk plötzlich als würdig erachteten, westliche und östliche Interessen mit der Waffe zu verteidigen? Auch daran sollten wir am 8. Mai denken. Der 8. Mai erinnert uns daran, daß wir besiegt wurden. Ja, wenn es nur die militärische Niederlage gewesen wäre. Es hätte nicht einmal das uralte Muster jener Kriege sein müssen, bei denen die Niederlagen kaum weniger ehrenvoll waren als die Siege. Aber Schuld eines ganzen Volkes für Verbrechen, die es als Volk nicht begangen hat, weil ein Volk keine Verbrechen begehen kann, sondern immer nur der Einzelne? Wenn von Schuld die Rede ist, dann auch von jener Schuld, daß wir nicht die Kraft und den Mut besaßen, uns gegen die generelle Herabsetzung zu wehren und uns nicht die Würde rauben zu lassen. Standfestigkeit und Unbeirrbarkeit wären um so nötiger gewesen, als uns das Gift der moralischen Selbstzerstörung Jahr für Jahr eingeträufelt wurde. Und wir wußten davon - denken wir daran. Wir haben keinen Grund, den 8. Mai zu feiern. Feiern sollen diejenigen, die sich für die Sieger halten. Wie unsere früheren Gegner, die sich heute als unsere Freunde bezeichnen, ihre Feiern am 8. Mai mit dieser Freundschaft 1945 in Einklang bringen, ist allerdings nicht nur ihr eigenes Problem. Für uns ist es eine Gelegenheit, daran zu erinnern, daß die neue Zukunft, die uns von den Siegern 1945 beschert wurde, für unser Reich das Grab und für Deutschland und das deutsche Volk die Katastrophe seiner Zerstückelung bedeutete. Die Siegesparaden der früheren Alliierten werden uns nur zeigen, daß wir noch immer die Besiegten von 1945 sind, daß unser Land besetztes Land ist und unsere regionale Souveränität eine von Gnaden der Sieger mit Vorbehalten gewährte Souveränität. Daran müssen wir denken. Die 40. Wiederkehr des 8. Mai 1945 ist das Fest der Sieger. Es ist nicht unser Fest. Uns dagegen steht die Erinnerung an Wahrheiten zu, deren Gehalt von keinem Datum abhängt. Zur Lebensgeschichte des Einzelnen wie zur Geschichte eines Volkes gehören die Niederlagen genauso wie die Triumphe. Nur dann, wenn sich der Einzelne, wenn sich ein Volk selbst aufgibt und sklavisch unterwirft, geht alles verloren - in der Variante einer Feststellung des römischen Kaisers Mark Aurel: »Laß dir die Vergangenheit, laß dir die Zukunft nicht verfälschen. Du wirst, wenn es nötig ist, schon hinkommen, mit Hilfe derselben Geisteskraft, die dich das Gegenwärtige ertragen läßt.«
Diogenes warf den Becher fort. Von Wert und Grenzen der Genügsamkeit, in: Rheinischer Merkur, 25.05.1985. Diogenes warf den Becher fort Das Problem ist uralt. Allerdings scheint jedes Problem, das uns wirklich zusetzt, um so substantieller zu sein, je älter es ist. Eine klassische Anekdote berichtet vom Besuch Alexanders des Großen bei Diogenes, dem kynischen Philosophen. Diogenes war bekannt für die originellen Beispiele, mit denen er seinen Mitbürgern das Glück der Bedürfnislosigkeit demonstrierte. Er trennte sich von allem, was ihm entbehrlich erschien. Ein Faß war seine Wohnung. Als er einen Knaben sah, der mit der hohlen Hand Wasser schöpfte, um zu trinken, warf Diogenes auch seinen Becher fort. Diogenes soll — oder wird vermutlich — den großen Alexander gefragt haben, was er denn mit seiner Macht eigentlich anfange. Alexander: „Wer Macht hat, besitzt alles!“ Diogenes: „Wer alles hat, besitzt noch weniger als nichts. Denn nur wer nichts hat, besitzt alles. Wahrer Reichtum beruht auf Bedürfnislosigkeit.“ Als der König den Philosophen fragte, ob er ihm einen Wunsch erfüllen könne, nickte Diogenes: „Ja, geh mir bitte aus der Sonne.“ Nur eine Anekdote. Und falls Anekdoten einen Kern haben, bleibt er meistens so allgemein und unverbindlich wie alle auserlesenen Weisheitsworte der Geschichte. Wir Menschen brauchen zum Überleben und Leben eine Menge von Vorrichtungen, Werkzeugen, Hilfsmittel, wir brauchen Kleidung, Behausung, Heizung, eigens zubereitete Nahrung, Hygiene. Wir brauchen nicht zuletzt auch Möglichkeiten, um unsere „zwecklosen“ Bedürfnisse zu stillen: Lektüre, Musik, Kunst, all das, was im Wort Kultur enthalten ist. Gibt es ein Existenzminimum für den Menschen? Wo liegt die Grenze, an der sich Lebensstandard in Luxus und Luxus in Nonsens verwandelt? Zwischen Diogenes und Oscar Wilde scheinen Welten zu liegen, jenem Oscar Wilde, der erklärt hatte, er würde gern auf alles Lebensnotwendige verzichten, wenn man ihm nur in seinem Leben den Luxus ließe. Bedürfnislosigkeit bis hin zu nackter Armut gehört nur dann in den Bereich der Werte, wenn die Möglichkeit eines anderen Lebenszuschnitts vorhanden ist. Freiwillige Entsagung hat zu aller Zeiten hohen Respekt geweckt. In unseren hochtechnisierten 80er Jahren wirkt der seltene Anblick einer Nonne, eines Mönchs anachronistisch bis zum Kopfschütteln — und er hinterläßt trotzdem den Stachel einer tiefen Bewunderung. Unsere Gesellschaft ist unfähig, auf Grund eines allseits akzeptierten Gruppenkodex anzugeben, was den unerläßlichen Lebensstandard ausmacht. Die Einstufung anhand eines bestimmten Geldbetrags ist nicht der Weisheit letzter Schluß, sondern der Anfang psychomoralischer Demütigungen: Rentner, Empfänger von Sozialhilfe, Arbeitslose wissen davon ein Lied zu singen. Gibt es keine direkte Beziehung zwischen den praktischen Leitwerten der Öffentlichkeit und dem Anspruch auf Daseinswürde auch jener, die kein Bankkonto besitzen? Daß wir diese Frage nicht beantworten können, ist für uns charakteristisch. In den schon so lange zurückliegenden Jahrzehnten, in denen es unseren Eltern so elend ging, gab es kein Problem des Lebensstandards. Jeder fand sich mit den materiellen Zuständen ab, jeder kannte Hunger, Angst, Verzweiflung — aber die Konzertsäle waren voll, die Opern- und Schauspielhäuser ausverkauft, kaum jemals gab es ein so lesehungriges Publikum wie damals. Hatte nur die Not eine neue Bewertung der Dinge erzwungen? Und wie rapide schlug das um! In einer Gesellschaft, die auf Überzivilisierung angelegt ist, läßt sich Bedürfnislosigkeit kaum rechtfertigen. Fast alles, was ihr widerspricht, gehört zu den Grundsteinen unserer Ordnung. Deshalb steckt in der Statussymbolik nach wie vor ein sittlich-charakterliches Kriterium. Zwischen dem neuesten Automodell und dem sündteuren Hang zu Oldtimern liegt die trübe Zone der Gebrauchtwagen. Sie erfüllen zwar ihren Zweck, aber ihre Besitzer haben unter dem Hautgout des verwitterten Lackes zu leiden. Ethnologen untersuchten in den letzten fünfzehn Jahren die Lebensbedingungen der Kanuri, der rund eintausend Bewohner der Sahara-Oase Fachi in der Republik Niger. Ihre wirtschaftliche Existenz beruht auf den Dattelpalmen, der Salzgewinnung aus unterirdischen Salinen und den Gärten, in denen vor allem Luzerne angebaut wird. Dreiviertel des Gartenlandes bleibt brach liegen. Die Produkte werden gegen Getreide und anderen Lebensbedarf getauscht, den Handel besorgen die Kamelkarawanen der Tuareg. Die Bewohner der Oase Fachi sind Muslim. Das Dasein dieser verschwindend kleinen Bevölkerungsgruppe inmitten der ungeheuren Weite der Sahara ist Tag für Tag aufs äußerste gefährdet. Sandstürme, Ausbleiben von Karawanen, Epidemien können über Nacht zu einer Katastrophe führen — ohne daß jemanden ein Verschulden träfe, ohne daß etwas daran zu ändern wäre. Die Kanuri sind berühmt für ihre Frömmigkeit. Sie hätten, so sagt man in der Sahara, ihre Oase durch einen „Wall von Gebeten" geschützt. In Fachi wird nur vormittags gearbeitet. Körperlicher Einsatz ist auf das Unerläßliche beschränkt. Die Kanuri könnten den Gartenbau erheblich ausweiten und mehr produzieren, als für ihren Bedarf nötig ist. Sie könnten auch nachmittags arbeiten und dadurch ihren Lebensstandard beträchtlich erhöhen. Das aber wird in Fachi ausnahmslos von allen abgelehnt, denn es ginge auf Kosten der freien Zeit, der Geselligkeit, der Gespräche, der Muße, der religiösen Übungen. Eine Beschneidung dieser Aktivitäten, die den Menschen in Fachi genauso wichtig sind wie die körperliche Arbeit, die das materielle Wohl sichert, würde jenes Imponderabilium verstümmeln, das unsereins als Lebensqualität bezeichnet. Wenn wir unsere Maßstäbe anlegen, müssen wir sagen, daß die Kanuri besser leben könnten, wenn sie wollten. Die Menschen in Fachi dagegen wissen, daß sich ihr Leben durch Hebung des materiellen Wohlstands unweigerlich verschlechtert, weil es sich mit Nebensächlichkeiten belasten und dadurch entwerten würde. Sie sind mit ihrem Dasein in selbstgewählter Bescheidenheit derart zufrieden, daß niemand daran denkt, die Oase zu verlassen. Leben diese Menschen im Mittelalter? Oder sind sie uns um Jahrzehnte und um wesentliche Einsichten voraus?
Kein Ende der Symbole, in: Rheinischer Merkur, 21.06.1986. Kein Ende der Symbole Am 28. Oktober des Jahres 328 rüstete sich Kaiser Konstantin zur Entscheidungsschlacht gegen seinen kaiserlichen Rivalen Maxentius. Kurz bevor die Truppen an der Milvischen Brücke nördlich von Rom zusammenstießen, erschien dem Kaiser am Himmel über der Sonne das Christus-Kreuz und die Weisung: „Damit siege“ – eine der berühmtesten Verheißungen, die wir gewöhnlich in der lateinischen Fassung zitieren: „In hoc signo vinces — in diesem Zeichen wirst du siegen.“ Konstantin siegte. Das Christus-Kreuz wurde zum Symbol für den Triumph des Christentums seit Konstantin. Heute vertrauen wir kaum noch solchen Wunderberichten und Erzählungen. Unter den Bedingungen der modernen Skepsis bleibt kaum etwas übrig von der Zumutung, außerhalb der Arena der kritischen Vernunft an Symbole, Symbolkraft und Symbolwirkung zu glauben. Konstantins Sieg führen wir nicht auf das Christussymbol, sondern auf die besseren Truppen zurück. Besitzen Symbole überhaupt eine Wirkkraft? Heute sind davon nur noch abergläubische Menschen überzeugt. Ausnahmen sind andererseits nicht nur amüsant. Der Atomphysiker Niels Bohr, Nobelpreisträger und einer der Väter der Atombombe, wurde von einem berühmten Kollegen besucht. Über der Haustür hing ein Hufeisen. „Sie glauben an dieses Glückssymbol?“ Bohr lächelte: „Ich habe gehört, daß es wirkt, auch wenn man nicht daran glaubt.“ In Symbolen kommt ein bestimmter Sinn zum Ausdruck. Sie lassen sich nicht definieren, ihr Bereich liegt hinter den intellektuellen Kulissen und jenseits der Begriffe. Das ist der Unterschied zwischen den Symbolen, den Sinn-Bildern und anderen Bildzeichen wie Emblemen oder Piktogrammen. Das Zeichen für den Fluchtweg bei Bränden in Hotels signalisiert ganz anderes als das Christusmonogramm. Im Vergleich mit früheren Epochen scheint heute der Gehalt des Symbolischen, das fast immer mit Magischem, Mythischem oder Religiösem verbunden war, zusammengeschrumpft auf Merkzeichen im technischen Feld. Die Glühbirne steht für Lichtschalter, ein Strich im Kreissektor für Scheibenwischer, der Totenkopf für Gift, dasselbe gilt für die Strichkürzel bei Kopierern, Verstärkern, allen technischen Bedienungsanleitungen. Mit den Symbolen älterer Zeiten hat das nichts zu tun. Am hartnäckigsten hat sich das Symbol im politischen Raum gehalten. Fahnen, Wappen, Nationalhymnen stehen in derselben Tradition wie die alten Herrschaftssymbole Zepter oder Krone. Der Elementarbezug des einzelnen dazu ist allerdings unterschiedlich. Am kräftigsten ist er in den Staaten mit einer offiziellen Ideologie. Die rote Fahne mit Hammer und Sichel kann die Augen des jungen Sowjetrussen zum flackern bringen. Seit Reagans Präsidentschaft mögen auch die Amerikaner bei den Klängen ihrer Hymne die rechte Hand inbrünstiger aufs Herz drücken. Demgegenüber leiden wir Westdeutschen nicht unter Hochdruck. Ob wir das als Merkmal eines fortschrittlichen oder wenigstens fortgeschrittenen Zustands bezeichnen oder, wie es die Älteren gerne tun, als Ergebnis der Erfahrungen faschistisch gebrannter Kinder: beides ist nur ein Indiz für unsere Beziehungslosigkeit gegenüber politischen Symbolen. Sowohl die Diskussionen anläßlich des Besuchs des US-Präsidenten in Bitburg als auch die Verdrießlichkeiten bei dem 30-Jahr-Jubiläum der Bundeswehr zeigen, wie schwer wir mit Symbolischem zu Rande kommen. Trotzdem ist keine Rede vom Ende der Symbole. Auch nicht bei uns. Zu allen Zeiten haben Symbole nicht nur Kräfte der Einbindung und der Zuordnung des einzelnen in einen Gruppenverband besessen, sondern auch orientierende Funktion. Das feiert heute Auferstehung in den Lapidarsprüchen auf Betonwänden und im Sticker. Der Aufkleber ist mehr als eine Mode, er ist Zeichen für das Symbolbedürfnis der Gegenwart, derselben Gegenwart, die sich so rührend deutlich als technisch cool gefällt. Das 18. Jahrhundert, das Zeitalter der Aufklärung — noch immer die Schlüsselepoche für uns — hat eine Fülle von Köpfen besessen, deren Einsicht der Dynamik der Veränderung voraus war und in der Fähigkeit, Empfehlungen der Regulierung zu formulieren, ebenso wer nachhinkte. Zumal der Adel entwickelte erstaunlichen Scharfblick, nicht nur im Frankreich der Enzyklopädisten, sondern auch in Deutschland. Eine der damals so seltenen jungen Damen, die sich im Vorgriff auf die Postmoderne in ihrer eigenen Gesellschaftsschicht heimatlos fühlte, ohne in einer anderen zu Hause zu sein, meinte bei einer Diskussion über Toleranz und den Zerfall des alten Glaubens durch die Attacken der Vernunft: „Jede Konfession braucht ein Gebet.“ Ihre Bemerkung galt dem Atheismus. Sie gilt genau für den Kampf unserer Grünen um den Wald oder gegen die Wiederaufbereitungsanlagen. Der Sticker ist heute so etwas wie das Gebet derjenigen, deren Wünsche von den Ahnungen ihrer Fähigkeiten getrieben sind. Es ging nicht gegen Traditionen, als die Studenten vor knapp zwei Jahrzehnten aufbegehrten, sondern gegen das Hohle. Der bekannte Spruch: „Unter den Talaren, Muff vor tausend Jahren“ schien einiges für sich gehabt zu haben. Hätten die Professoren sonst so rasch auf die Talare verzichtet? Die timide Seinsferne im akademischen Raum dürfte nicht allein ausschlagend gewesen sein. Jedenfalls war unstreitig etwas von dem Symbolischen mit im Spiel, das sich so unvergleichlich doppelbödig in dem säuberlich mit wasserfestem Faserstift geschriebenen Satz auf einem Warmluft-Händetrockne; äußerte: „Das hilft auch nichts mehr Pilatus.“ Bilder sagen mehr als tausend Worte Und im Meer des Optischen, in dem wir schwimmen, tauchen seit längerem immer häufiger auch die Sinnbilder wieder auf. Die Kraft der Bilder kompensiert den Verfall der Ausdrucksfähigkeit unserer Sprache im öffentlichen Bereich. Daß wir die Lücken, die durch die „Sprachlosigkeit“ entstehen, mit Symbolen füllen, ist verständlich. Wer die Behauptung von der Entleerung des Gesagten und der Verrottung der Aussagekraft des Wortes bezweifelt, sollte die Reden der Mehrheit unserer Politiker untersuchen. Er wird dabei einiges vor den Empfehlungen der Stoiker begreifen. Das Symbol setzt einen festen Daseinsbezug voraus. Deshalb enthalten Symbole nur für denjenigen einen Sinn der ein Verhältnis zu dem besitzt, was sich im Symbol ausdrückt. Das Symbol der Fahne läßt uns, vor dem Hintergrund des Zustands, in dem wir uns staatlich eingerichtet haben, zu Recht indifferent bis kühl. Die Sticker-Symbole „Ja!“ oder „Nein!“ im weißen Kreis verstehen wir dagegen ohne Kommentare. Sie sprechen Empfindliches an. Wir sollten die Symbolkraft solcher Aufkleber nicht unterschätzen. Formeln wie „Atomkraft? Nein danke!" erschöpfen sich nicht im reinen Appell. Man kann die Hoffnung darin selbstverständlich als Träumerei abtun und die Achseln zucken Aber alle echten, großen Träume des Menschen drehen sich um Dinge, die er nicht tun kann. Zumindest noch nicht
Die größte Seeschlacht der Weltgeschichte. Skagerrak: Der Mythos, die Wirklichkeit, das Vergessen, in: Mut, Nr. 231, Asendorf, November 1986. Die größte Seeschlacht der Weltgeschichte. Alfred Graf Schlieffen, der deutsche Generalstabschef, hatte seinem Nachfolger Helmuth von Moltke für den Fall eines künftigen Zweifrontenkrieges eine Aufzeichnung hinterlassen, die als Schlieffenplan — vielzitiert und vielumstritten — in die Geschichte eingegangen ist. Dieses sogenannte „Testament des Grafen Schlieffen“ aus dem Jahr 1905 war Schlieffens letzte amtliche Denkschrift. Der Plan sah vor, den Osten praktisch von allen Streitkräften zu entblößen, dafür im Westen sämtliche militärischen Kräfte zu konzentrieren, den Durchmarsch durch Belgien mit einem starken rechten Flügel zu erzwingen, die französischen Armeen in einer großen Umfassungsschlacht zu umzingeln und zu vernichten. Schlieffen war von der Lage im Jahr 1905 ausgegangen, deshalb versuchte Moltke, den Plan der veränderten Situation zu Beginn des Ersten Weltkrieges anzupassen. Er schwächte den rechten Flügel zugunsten des linken, um das Risiko eines Vorstoßes der Franzosen durch Lothringen zu mindern. Mindestens ebenso folgenreich war das Versäumnis, daß Moltke den Schlieffenplan nicht mit den strategischen Plänen der Reichsmarine abstimmte, obwohl mit dem Eingreifen Englands fest gerechnet werden mußte, falls die belgische Neutralität verletzt wurde. England hatte bereits 1912 zugesichert, umgehend ein Expeditionskorps von 100 000 Mann nach Frankreich übersetzen zu lassen, um den Einmarsch der deutschen Truppen durch Belgien nach Frankreich abzuwehren. Kaum war der Krieg 1914 ausgebrochen, wurden die britischen Truppen umgehend in Transportern nach Frankreich übergeführt. Die britische Führung rechnete fest damit, daß die deutsche Marine mit allen Mitteln versuchen würde, diese Verstärkung der französischen Armee zu verhindern. Doch entgegen sämtlichen Erwartungen und Befürchtungen zeigte sich kein einziges deutsches Kriegsschiff. Trotzdem wurde von Tag zu Tag die britische Marineführung nervöser, da sich niemand die Untätigkeit der Deutschen erklären konnte. Sie hatten gerade in diesen Wochen, wie Churchill dem Befehlshaber der Schlachtflotte, Admiral Jellicoe, warnend vorgehalten hatte, „den stärksten Anreiz, etwas zu unternehmen“. Da dies nicht der Fall war, mußte die deutsche Marine offensichtlich noch etwas weit Bedrohlicheres im Schilde führen. Die deutsche Flotte wird in Watte gepackt Doch nichts geschah. Zwischen dem 14. und 18. August des Jahres 1914 überquerten britische Truppentransporter 137mal den Kanal, ohne daß auch nur eine einzige Rauchfahne an der Kimm gesichtet wurde, die von einem deutschen Kriegsschiff stammte, oder daß auch nur das kürzeste Funksignal von der deutschen Flotte aufgefangen wurde. Dabei war das englische Expeditionskorps für die Kämpfe in Frankreich von größter Bedeutung, zumal in den ersten Wochen des Krieges. Admiral Tirpitz, der Schöpfer der deutschen Kriegsmarine und damals Staatssekretär des Reichsmarineamtes, war sogar der Meinung, daß entgegen dem Schlieffen-Plan das Durchtrennen der englischen Etappenlinien und ein Durchstoß der deutschen Truppen nach Calais, der Hafenstadt an der engsten Stelle des Ärmelkanals gegenüber der englischen Stadt Dover, am wichtigsten gewesen wäre: „Alles übrige wäre uns leichter gefallen, wenn wir erst die Engländer durch Abschneiden von den Kanalhäfen gezwungen hätten, die Überschiffung nach Cherbourg oder gar nach Brest vorzunehmen, also über den Atlantik statt über einen Binnensee, was dem Krieg in Frankreich ein anderes Gesicht gegeben hätte.“ Ein Blick auf die Landkarte scheint Tirpitz recht zu geben. Es existierten noch andere triftige Gründe. Das gibt der Frage, wo denn die deutsche Kriegsmarine in diesen Wochen zu finden war, ihre ganze Dringlichkeit. Immer wieder haben die Historiker behauptet, daß sich das Übergewicht der Militärs über die deutsche politische Führung nirgends so verhängnisvoll ausgewirkt hätte wie im Ersten Weltkrieg. Auf die deutsche Flottenführung trifft das nicht zu, und man ist geneigt, zu ergänzen: Leider trifft das nicht zu. Ein wesentlicher Fehler bestand zunächst darin, daß es keine Oberste Seekriegsleitung gab. Tirpitz hatte zwar am 29. Juli 1914 ein einheitliches Oberkommando der Kriegsmarine gefordert und diesen Wunsch wiederholt erneuert, doch der Kaiser betrachtete die Flotte als ein rein defensives Instrument und sah die Notwendigkeit der Forderung von Tirpitz nicht ein. Auch der Obersten Heeresleitung erschien zu Beginn des Ersten Weltkriegs die Kriegführung auf See fast als eine nebensächliche Angelegenheit. Sie hatte nicht ernstlich zur Kenntnis genommen, daß mit dem Gegner England die stärkste Seemacht der Welt zu bekämpfen war und deshalb die Koordination von Heer und Marine zu den wichtigsten strategischen Grundnotwendigkeiten zählte. Noch folgenschwerer wirkte sich in den ersten Wochen der Umstand aus, daß tatsächlich die Politik die Kriegführung beeinflußt, und nicht umgekehrt. Reichskanzler Bethmann-Hollweg war in den letzten Jahren von der Zuversicht erfüllt gewesen, eine Verständigung mit England sei nicht nur eine Hoffnung oder begründete Erwartung, sondern sei aus sachlichen Gründen notwendig, und dies würde die britische Regierung daran hindern, sich um Frankreichs und Rußlands willen in einen Krieg einzulassen. Diese Zuversicht des deutschen Reichskanzlers hätte nicht bitterer enttäuscht werden können als im Juli und August 1914. Die deutsch-britische Verständigung erwies sich, wie sich Bethmann-Hollweg eingestehen mußte, als ein „Kartenhaus“. Die Beziehungen zwischen beiden Ländern hatten sich zwar seit 1912 überaus vielversprechend entwickelt, doch die Basis war noch zu schmal, auf der sie aufgebaut worden waren. Berücksichtigt man die Entschlossenheit der kriegswilligen Politiker in England, die sich mit ihren Argumenten schließlich durchsetzten, so war letzten Endes der Entschluß der britischen Regierung, nicht neutral zu bleiben, richtig. Denn ohne England wäre das Deutsche Reich schwerlich zu besiegen gewesen. Doch der deutsche Reichskanzler war nicht der Mann, um aus der englischen Kriegserklärung die richtigen Folgerungen zu ziehen. Für ihn blieb die britische Entscheidung ein Entschluß wider besseres Wissen. England, so war Bethmann-Hollweg überzeugt, sei ganz unwillentlich in den Krieg hineingezogen worden: „Der Krieg mit England ist nur ein Gewittersturm, der rasch vorüberbraust. Nachher wird das Verhältnis besser denn je.“ Deshalb drang er mit aller Entschiedenheit darauf, selbst während des Krieges mit dem Gegner England so behutsam wie nur möglich zu verfahren. Es sei verkehrt, die britische „Bulldogge zu reizen“. Und sie wäre durch nichts stärker zu reizen als durch die Flotte. Deshalb solle sich die deutsche Marine zurückhalten. Reichskanzler Bethmann-Hollweg war außerdem der Meinung, die Flotte müsse möglichst unversehrt durch den Krieg gebracht werden, damit man sie bei Friedensverhandlungen als Argument ausspielen könne. Was für ein Argument sich allerdings mit einer Flotte verknüpfen lassen würde, die nie einen Beweis ihres Kampfwertes angetreten hatte — dies zu verstehen blieb nur dem deutschen Reichskanzler vorbehalten. Admiral Tirpitz vertrat strikt die entgegengesetzte Meinung. Er war unfähig, der Logik des Reichskanzlers zu folgen: „Es war nach meiner Auffassung der helle Widersinn, die Flotte in Watte zu packen. Solche Zurückhaltung hatte Sinn für England, weil dessen Flotte dadurch ihren Zweck, die Meere zu beherrschen, erfüllte. Für Deutschland aber, dessen Ziel es sein mußte, das Meer frei zu halten, war der Grundsatz unsinnig. Ferner durften wir den Krieg nicht zum Erschöpfungskrieg ausarten lassen und mußten versuchen, die Sache kurz zu machen. Wie klug es die Engländer angefangen haben würden, die Entschlußkraft maßgebender Männer in Deutschland zu lähmen, dafür zeugt der Ausspruch, den einer der nächsten Berater nach der Schlacht vor dem Skagerrak getan haben soll und der sich jedenfalls durchaus in die Gesamtstimmung dieser Kreise einfügt: Schade! Wir waren nahe daran gewesen, von England Frieden zu bekommen. Unter solchen Einflüssen ist des Kaisers eigenes Werk zerstört worden.“ Tirpitz betrachtete die Lage keineswegs nur aus der Perspektive eines Marinefanatikers. Seine Analyse war exakt: „Im Juli 1914 trieb die politische Leitung eine gefährliche Politik, die, wenn sie überhaupt gewagt werden sollte, nur au eine seemächtige Reichsgewalt gegründet werden konnte. Als der Krieg aber da war, wurde die Flotte tunlichst entwertet und der unmögliche Versuch unternommen, den Krieg gegen England vor Paris zu gewinnen, vor allem aber England durch militärisch schonende Behandlung zu einem für uns gnädigen Frieden umzustimmen, der nun einmal nicht zu bekommen war. Im Frieden hatte der Kanzler unsere Flotte im Innersten weggewünscht; im Krieg tat er, als ob sie nicht vorhanden wäre. Die deutsche Reichsleitung hatte sich eben niemals mit dem Gedanken befaßt, wie man einen Krieg gewinnt, sondern diese Sorge dem Generalstab der Armee überlassen, der wiederum nicht zuständig war für die politischen, wirtschaftlichen und seestrategischen Fragen eines Weltkrieges.“ Tirpitz und mit ihm die weiterblickenden Marineoffiziere befanden sich mit ihrer Überzeugung, daß nur eine offensive Seestrategie einen Sinn besäße, in einer Isolierung, die nicht verhängnisvoller hätte sein können: „Auf der See wurde um noch größere Dinge gerungen als auf dem Lande.“ Tirpitz und mit ihm der damalige Chef der Hochseeflotte, Friedrich von Ingenohl, drängten unablässig zu sofortiger Aktivität: „Nur stärkste Mittel konnten uns retten. Wir mußten die Grand Fleet' mindestens empfindlich schädigen.“ Doch alle Vorstellungen waren umsonst, Tirpitz erschöpfte sich in dem geradezu grotesken Versuch, der politischen Führung deutlich zu machen, daß eine Seemacht nur auf See zu schlagen sei. Noch immer galt die Flotte Großbritanniens, die Royal Navy, als die größte, die beste Marine der Welt. Seit Admiral Nelsons Triumph bei Trafalgar am 21. Oktober 1805 über die vereinigte französisch-spanische Flotte lebte sie von dem Mythos der Unbesiegbarkeit. Tirpitz betrachtete ganz richtig diesen Mythos als eine ebenso handgreifliche Wirklichkeit wie ein kampfstarkes Schlachtschiff. Folglich kam es darauf an, diesen Mythos zu zerstören, es mußte der Welt gezeigt werden, daß die Royal Navy zu besiegen war. Und Tirpitz war genauso wie alle Besatzungen der Schiffe unerschütterlich von der Überlegenheit der deutschen Kriegsmarine überzeugt: die britische war zu schlagen. England beurteilte von seinen Voraussetzungen her die Situation genauso wie Tirpitz. Die Entscheidung in diesem Krieg fiel auf See. Deshalb durfte der Nimbus der Navy, der britische Mythos von der unantastbaren, durch nichts zu erschütternden Seemacht nicht zerstört werden, und deshalb konzentrierte England auch seine stärksten Seestreitkräfte in der Nordsee. Die Admiralität schätzte die Schlagkraft der deutschen Flotte hoch genug ein, jedenfalls so hoch, daß sie, solange wie nur irgend möglich, eine mehr als vorsichtige Zurückhaltung pflegte. Bis zu demjenigen Tag, an dem die deutsche Flotte ihre Kräfte mit der Navy gemessen hatte, galt Großbritannien als diejenige Seemacht der Welt, die von niemandem zu schlagen war. Der Gegenbeweis mußte erst noch geliefert werden. Solange es den Deutschen nicht gelang, die Briten zu stellen, solange waren sie die Unterlegenen. Die britische Marine hatte es in der Tat nicht nötig, ihren Ruf zu verteidigen. Ihr Ruf konnte nur durch den Gegner selbst zerstört werden. Aus diesem Grund konnte die Royal Navy durch eine „precipitate and costly action“ durch eine überstürzte und kostspielige Aktion, nur verlieren. Auch ihre Führung und mit ihr jeder Matrose waren überzeugt, daß England die unübertrefflichste und gewaltigste Seemacht aller Zeiten besaß, — aber aus reinem Übermut würde sie sich trotzdem nicht mit den Deutschen auf einen Kampf einlassen. Als in den ersten Wochen des Kriegs die deutsche Marine praktisch unsichtbar blieb, triumphierte der Daily Telegraph zurecht: „Solange sich die deutsche Flotte versteckt, heimsen wir alle Vorteile der Seeherrschaft ein.“ So wurde für die Royal Navy ein Paradox zum Prinzip der Strategie: Je länger unsere Untätigkeit zur See anhält, um so stärker werden wir. Tirpitz erkannte, daß für Deutschland das genaue Gegenteil gelten mußte: „So wie die englische Flotte verfuhr, konnten wir nur durch Offensivgeist, nicht durch passives Abwarten etwas gewinnen. Nur mit fast unerträglichem Schmerz kann man an die weltverändernde Wirkung denken, welche eine durchgeschlagene Seeschlacht in den ersten Kriegsmonaten gehabt haben würde.“ Auch unter kriegsgeschichtlichen Gesichtspunkten muß der Entschluß der deutschen Führung, die Hochseeflotte „in Watte zu packen“, als die folgenschwerste militärische Fehlentscheidung des Ersten Weltkriegs angesehen werden. Scheer bringt Bewegung So war es zu der oft erwähnten Patt-Situation gekommen, in der die Grand Fleet und die deutsche Hochseeflotte seit Kriegsbeginn verharrten. Wenn behauptet wird, daß die Kriegsmarine in die Nordsee eingesperrt war, dann muß man ergänzen: Sie hatte sich aufgrund eines Entschlusses der deutschen Führung selbst eingesperrt. Die britischen Inseln lagen als gewaltige Sperre vor der Nordsee und der deutschen Bucht. Der Kanal wurde von den Schiffen der Channel Fleet abgeriegelt, im Norden war die Grand Fleet postiert. Diese weit gespannte Blockade verwehrte der Hochseeflotte den Durchbruch in den Atlantik, sie schnitt aber das Deutsche Reich vom Überseehandel ab: ein Würgegriff, der zu den kriegsentscheidenden Faktoren zählte.
Der Grundsatz der strategischen Defensive bedeutete zwar, daß England zum ersten Mal mit seiner jahrhundertelangen, ruhmreichen Seekriegstradition brach, aber anders war die Formel nicht aufrechtzuerhalten, daß die Royal Navy solange im Zeichen des Sieges stand und sich im Glanz ihrer Unbesiegbarkeit sonnen durfte, solange es zu keiner Seeschlacht kam. Auch nach knapp zwei Kriegsjahren galt außerdem, was schon anfangs bekannt war: daß Deutschland neben England die stärkste und gefährlichste Kriegsmarine der Welt besaß. Ihre Admirale, Kommandanten, Besatzungen hatten zwar kaum Kampferfahrung, aber warum sollten die deutschen Matrosen andere Eigenschaften besitzen als die deutschen Soldaten an Land? Bis zum Beginn des Jahres 1916 hat die deutsche Hochseeflotte nichts anderes erreichen können als die Erlaubnis, die Aktionsfähigkeit der Royal Navy nur durch Dezimierungsunternehmungen herabzusetzen. Eine größere Schlacht durfte ausdrücklich nur dann riskiert werden, wenn von vornherein die hohe Chance eines Sieges gegeben war. Im Januar 1916 wird Admiral Reinhard Scheer Chef der Hochseeflotte. Scheer ist der schärfste Gegner des passiven Seekriegskonzepts. Mit ihm kommt plötzlich Bewegung in die Erstarrung der Flotten. Er schickt seine Geschwader zu überfallartigen Aktionen in die Nordsee, es handelt sich um weit mehr als nur um Nadelstiche, er versucht, die englischen Schiffe aus den Blockadestellungen zu locken. Der 31. Mai 1916 Am frühen Morgen des 30. Mai 1916 strahlt das Flaggschiff Scheers Friedrich der Große ein Funksignal zum Sammeln der Flotte auf der äußeren Jade aus. Das Signal wird von den Briten aufgefangen und entschlüsselt; der Geheimkode der deutschen Marine und der Schlüssel zum Chiffriersystem ist ihnen schon seit 1914 bekannt. Sie schließen aus dem Funkspruch auf eine bevorstehende große Unternehmung. Am 31. Mai, frühmorgens um 4.00 Uhr, verläßt die deutsche Hochseeflotte den Jadebusen. Die Schiffe marschieren in Kiellinie, Richtung Norden. Am Abend wollen sie am Skagerrak, zwischen Jütland und der norwegischen Küste sein. Doch eine Handvoll Stunden zuvor hat der Chef der Grand Fleet, Admiral John Rushworth Jellicoe, seine Linienschiff-Geschwader auslaufen lassen, um die Deutschen vor dem Skagerrak abzufangen. Wenige Stunden später dampft die deutsche Flotte rüstig und ahnungslos in Kiellinie nach Norden. Alle — vom Kommandanten bis zum Heizer — sind überzeugt, daß die Schiffe nur zu einer der üblichen Routineübungen auslaufen. Scheer weiß nicht, daß auch die ganze Grand Fleet im Anmarsch ist. Weit vor dem Gros dampft das Schlachtkreuzer-Geschwader Vizeadmiral Franz von Hippers. Nachmittags wird im Westen eine Rauchfahne gesichtet. Zwei Torpedoboote werden zur Aufklärung hinübergeschickt. Es handelt sich um einen harmlosen dänischen Frachter. Plötzlich jaulen Granaten, über den Horizont schieben sich die Silhouetten britischer Kreuzer, Schiffe der Vorausabteilung Vizeadmiral David Beattys. „Feind in Sicht“ und „Klar Schiff zum Gefecht“ — nach diesen Signalen jagen die Geschwader mit Volldampf aufeinander zu. Um 15.32 Uhr eröffnet der Kreuzer Elbing das Feuer, rauscht die erste deutsche Salve der größten Seeschlacht der Weltgeschichte in Richtung der Briten. Der Zusammenprall der beiden mächtigsten Kriegsflotten der Welt an diesem Tag überbietet alles, was die Seekriegsgeschichte kennt. Hippers Panzerkreuzer sind nach Feuerstärke, Zahl und Geschwindigkeit den Schlachtkreuzern Beattys fast aussichtslos unterlegen. Doch die deutschen Salven kommen so schnell und massiert, ohne Streuung und unerhört treffsicher, daß ein britischer Offizier die Überzeugung äußert, ihr Geschwader würde gegen die ganze deutsche Hochseeflotte kämpfen. Nach 15 Minuten sank der erste britische Schlachtkreuzer, die Indefatigable, von den 1017 Mann Besatzung konnte ein deutsches Torpedoboot nur zwei Mann retten. Knapp 20 Minuten später flog die Queen Mary — das schönste Schiff der Royal Navy, ihr„show-ship“— mit einer ungeheuren Explosion in die Luft, 1274 Mann starben, acht wurden gerettet. Als Beatty die Queen Mary in die Luft fliegen sah, schüttelte er fassungslos den Kopf, starrte unter dem Jaulen der deutschen Salven, im Rauch des eigenen Geschützfeuers, im höllischen Lärm der Detonationen auf die riesige Rauchwolke, die bis zu 300 Metern über der Stelle schwebte, an der die Queen Mary versunken war, und sagte zu seinem Flaggschiffkommandanten: „Chatfield, mit unseren verdammten Schiffen scheint etwas nicht in Ordnung zu sein.“ Nicht nur auf den britischen Schiffen, auch bei Vizeadmiral Beatty und der gesamten britischen Flotte war „etwas nicht in Ordnung“. Beatty sah sich nicht in der Lage, in diesem ungleichen Gefecht der Schlachtkreuzer, das rund eine Stunde dauerte, seine gewaltige Übermacht auszuspielen. Da hatte er mit zehn modernsten Großkampfschiffen fünf erheblich schwächere deutsche Panzerkreuzer vor sich, und sie sprangen so mit ihm um, wie er es mit Hippers Schiffen vorgehabt hatte: „Ich habe hier den besten Flottenverband der Welt. Wenn ich auf Hipper und seine Panzerkreuzerstoße, kann ich mit ihnen fertig werden.“ Doch Beatty wurde im Gefecht der Schlachtkreuzer entscheidend geschlagen. Zwei seiner Schiffe waren in Grund geschossen, die anderen hatten schwere Treffer hinnehmen müssen, mit am beklemmendsten aber war für die Briten, daß die deutschen Schlachtkreuzer, wenn die Briten schon einmal Treffer erzielten, aufgrund der besseren Panzerung praktisch keine Wirkung zeigten. Das Ringen der Großkampfschiffe, das eigentliche Gigantentreffen beginnt erst am frühen Abend. Vor den Geschwadern Admiral Scheers recken sich am Horizont von Norden nach Osten in einer unabsehbaren Linie, schemenhaft, die gewaltigen Schlachtschiffe Jellicoes, eine feuerspeiende Riesenkette, die als Ziel für die Deutschen allerdings kaum auszumachen ist. Scheer schreibt in seinem großen Bericht: „Der ganze Bogen, von Norden bis Osten reichend, war plötzlich ein Feuermeer. Deutlich hob sich das Mündungsfeuer der Geschütze aus dem auf dem Horizont lagernden Dunst und Qualm ab, in welchem die Schiffe selbst zunächst nicht erkennbar waren. Damit begann der Hauptabschnitt der eigentlichen Schlacht.“ Die Briten stehen mit 28 modernen Schlachtschiffen den 16 Linienschiffen des ersten und dritten Geschwaders Scheers gegenüber. Die sechs völlig veralteten Schiffe des zweiten Schlachtgeschwaders, die Scheer nur auf ausdrückliches Bitten Konteradmiral Franz Mauves mitgenommen hatte, sind wegen ihrer begrenzten Möglichkeiten nur eine Behinderung. Admiral Jellicoe versucht, die Hochseeflotte zu umklammern. Die Position der deutschen Schiffe hätte im Augenblick nicht schlechter sein können: Vor ihr, im Nordosten, wie ein weit geöffneter Rachen, das Gros Jellicoes, verborgen hinter Dunstschleiern, Qualm und Rauch. Die Sichtverhältnisse für die deutschen Geschützführer sind katastrophal, das Fiasko scheint sich endgültig abzuzeichnen, als das dritte britische Schlachtkreuzergeschwader Admiral Hoods auftaucht. Wie sollen sich die deutschen Schiffe lösen und eine günstigere Gefechtsposition gewinnen? Da gibt Admiral Scheer den Befehl zu einem Manöver, das in der Royal Navy unbekannt ist: „Gefechtskehrtwendung nach Steuerbord bis zur Herstellung der Kiellinie in entgegengesetzter Richtung!“ Eine solche Kehrtwendung der Schiffe um 180 Grad, um sofort wieder in Formation zu sein, bildet das schwierigste Manöver, das unter Gefechtsbedingungen überhaupt möglich ist. Doch das Manöver wird mustergültig ausgeführt, wie „Geister in den Nebel“ entschwinden die deutschen Schiffe plötzlich der Sicht Jellicoes, der mit seinen Offizieren völlig verwirrt ist: „Ich glaubte, das Verschwinden des Feindes sei lediglich dem dichter werdenden Nebel zuzuschreiben. Nach einigen Minuten aber war es klar, daß es dafür einen anderen Grund geben mußte.“ Jellicoe zeigt sich hilflos. Die Briten stellen das Feuer ein, Jellicoe behält seinen Südost-Kurs bei. Scheer steht jetzt etwa 11 Seemeilen westlich von der englischen Schlachtlinie. Behalten die Briten ihren Kurs bei, dann können sie den Deutschen den Rückweg abschneiden. Ohne daß er es zunächst weiß, ist Jellicoe drauf und dran, die Hochseeflotte hinaus in die Nordsee zu drängen. Doch kaum eine Viertelstunde nach Abschluß der ersten Gefechtskehrtwendung wiederholt Scheer das Signal, vollzieht die Wendung noch einmal, führt seine Schiffe erneut dem Feind entgegen. Das Manöver ist noch ungewöhnlicher als das erste, denn es wäre zu erwarten gewesen, daß Scheer aufgrund der Überlegenheit Jellicoes versuchen würde, mit der Hochseeflotte zu entkommen und den Heimathafen zu erreichen. Doch davon ist keine Rede. Kaum ist die zweite Wendung ausgeführt, entbrennt die Schlacht wieder zu voller Stärke. Jellicoe ändert den Kurs seiner Linie in Richtung Scheer: Südwest zu West. Scheer wirft, als er die Kursänderung der Briten erkennt, die Schlachtkreuzer ohne Rücksicht nach vorn, befiehlt auch kurz darauf den Angriff sämtlicher Torpedobootsflottillen. Der Angriff der Aufklärungsgruppe Hippers und der Torpedoboote ist ein Bravourstück ohne Vergleich. Die niedrigen grauen Schiffe jagen in ein Inferno von Aberhunderten von Einschlägen, pflügen sich durch die tosende See, gegen die feuerspeiende Wand der Großkampfschiffe, hinein in einen Hagel der Vernichtung. Doch kein Schiff bricht aus der Formation, alle bleiben im Angriff. Unmittelbar bevor das Signal zum Torpedoangriff gesetzt wird, gibt Admiral Jellicoe den Befehl, hart nach Backbord abzudrehen. Das hat schwerwiegende Folgen, denn diese Wendung führt die Briten vom Feind weg, es ist der Entschluß, sich von den Deutschen zu lösen. Scheer bleibt weiter auf Südwestkurs, läuft aus dem Bereich der britischen Geschütze, den Engländern geht die Gefechtsführung verloren. Auch kein einziges britisches Zerstörergeschwader unternimmt einen entschlossenen Angriff auf die Hochseeflotte. Das ist im übrigen charakteristisch für den ganzen Verlauf der Schlacht und ergibt sich aus der unterschiedlichen Kommandostruktur der Royal Navy und der deutschen Marine. Die Briten sind zentral geführt, weder im ersten noch im zweiten Teil der Skagerrak-Schlacht gibt es eine einzige britische Einheit, die selbständig, aggressiv und aufgrund der aktuellen Gefechtslage operiert, also eigene Entschlüsse faßt und sie mit dem Flottenführer abstimmt. Im Gegensatz dazu handeln die Deutschen nach dem Prinzip, in kritischen Situationen diejenigen Maßnahmen zu treffen, die notwendig erscheinen. Elastizität und Selbstverantwortung bei der deutschen Marine stehen dem starren Festhalten an den Plänen und dem Vorrang der Befehlsgewalt der Flottenführung gegenüber. Als Jellicoe den Befehl zum Abdrehen gibt und damit die Schlacht abbricht, dominiert wiederum seine Vorsicht und vor allem das Empfinden, keinerlei Risiko einzugehen, das unübersehbare Eventualitäten einschließt. Die Briten hätten vor dem Einbruch der Nacht noch mehr als eineinhalb Stunden Gelegenheit gehabt, bei völlig ausreichender Sicht mit Volldampf den Deutschen nachzusetzen und sie erneut zu stellen. Das wird bewußt unterlassen. Im Gegenteil, kurz nach dem deutschen Torpedobootsangriff signalisiert Jellicoe dem Leichten Kreuzer Calliope, nicht zu dicht an den Feind heranzugehen. In der frühen Nacht kreuzt sich der Kurs der beiden Flotten. Die Spitze der Linie Scheers berührt die englische Nachhut. Von diesem Moment an kommt es zu langen, erbitterten Gefechten in der Nacht unter schweren Verlusten der Briten. Da der Kurs der Gegner nicht genau parallel ist, laufen die Flotten voneinander weg. Jellicoe hält sich an seinen strikten Südkurs, entfernt sich also mit vollem Wissen von der Hochseeflotte und ist sich darüber im klaren, daß er Scheer unmöglich bei Anbruch der Morgendämmerung nochmals stellen kann. Die Bilanz Der Ausgang der Schlacht und die Frage nach dem Sieger wird von den Marineexperten der ganzen Welt noch immer mit Vorliebe diskutiert — nicht zuletzt deshalb, weil es sich um das interessanteste und komplizierteste Seegefecht der Geschichte handelt. Nach jener Logik, für die ein Sieg die völlige Vernichtung des Gegners bedeutet — so wie die Japaner in der Seeschlacht von Tsushima im Jahre 1905 über die Russen siegten und Nelson bei Trafalgar —, gab es keinen Sieger. Doch diese Logik entspricht nicht der Sachlage. Gegen die Briten mit weit über 30 Großkampfschiffen standen die 22 Schlachtschiffe Scheers. England hatte 6945 Tote zu beklagen, die Deutschen 2921, und sie versenkten fast doppelt soviel Schiffsraum, als sie selbst verloren: 115 025 Tonnen auf britischer Seite, 61 180 auf deutscher. Die Schlacht am Skagerrak endete mit einem deutschen Triumph. Er war um so eindrucksvoller, als er von einer Kriegsmarine errungen wurde, die noch nicht einmal zwei Jahrzehnte existierte, und ihr Gegner besaß die glorreichste Seetradition aller Zeiten. Am Skagerrak errang Admiral Scheer nicht nur einen taktischen Erfolg, wie man noch heute so oft lesen kann, sondern er brachte die Royal Navy ins größte Desaster ihrer Geschichte. Skagerrak war ein Sieg der deutschen Waffentechnik, des Schiffsbaus, der Artillerie, der Panzerung, der Geschützführer — von der kühnen Selbstverantwortung zu schweigen. Admiral Jellicoe hatte schon 1914 in einer Vergleichsstudie schonungslos festgestellt, „daß uns die Deutschen in den technischen Qualitäten voraus sind“. Die Studie blieb geheim. Erst Scheer zeigte der Weltöffentlichkeit das Fiasko der englischen Technologie. Churchill schrieb damals, daß Admiral Jellicoe der einzige Mensch gewesen sei, der am 31. Mai 1916 in wenigen Stunden den ganzen Krieg hätte verlieren können. Das ist richtig. Jellicoe hätte ihn aber auch am selben Nachmittag gewinnen können. Wäre die deutsche Flotte vernichtet worden, hätte Deutschland nicht den unbeschränkten U-Boot-Krieg erklären können, die Royal Navy hätte die Nordsee fest in die Hand bekommen, die Ostsee wäre ihre Domäne geworden, Rußland hätte unbegrenzt Kriegsmaterial erhalten — der Mangel an Munition, Waffen, Ausrüstung war ein Hauptgrund für den russischen Zusammenbruch 1917 und die Oktoberrevolution. Und für Deutschland hätte ein vernichtender Sieg der Briten nicht nur militärisch, sondern auch und vor allem moralisch verheerende Folgen gehabt. So aber gab Skagerrak den Mittelmächten einen ungeheuren Auftrieb. Der angeblich nur taktische Sieg der Deutschen veränderte die Kriegssituation grundlegend. Das Selbstbewußtsein, die unbedingte Entschlossenheit, bis zum Sieg durchzuhalten, wurde gestärkt wie durch kein anderes Ereignis. Doch ausschlaggebend war schließlich nicht der glänzende Erfolg der deutschen Flotte, ausschlaggebend waren die Konsequenzen für England. Ein britischer Historiker unserer Zeit kommt zu der Bilanz, daß mit Skagerrak die Schlußphase britischer Weltmacht und maritimer Überlegenheit beginnt, die dann 1945 unwiderruflich endet, „als die britische Schlachtflotte nichts anderes mehr war als der Kampfverband 77 in der Pazifik-Flotte der Vereinigten Staaten, und England zu finanzieller Abhängigkeit herabgesunken war. Was Scheer im Jahre 1916 begann, vollendeten die Japaner in den Jahren 1941/42.“ Auf dem Grabstein von Reinhard Scheer steht ein einziges Wort: Skagerrak. Der englische Marinehistoriker Julian Corbett meinte: „ Was Admiral Scheer erreicht hat, ist des Ruhmes genug, um ihn den großen Flottenführern aller Zeiten ebenbürtig zur Seite zu stellen.“ Scheer starb am 26. November 1928. Der November ist bei uns derjenige Monat, in dem der Toten gedacht, in dem der Volkstrauertag begangen wird. Seit den beiden Weltkriegen unseres Jahrhunderts wird bei uns bohrender denn je über den Sinn und die Sinnlosigkeit von Kriegen nachgedacht. Jedem von uns gilt das Faktum des Krieges als ein absolut schauerliches Ereignis. Daß von dieser Einschätzung her kein Weg zu jener Haltung führt: daß es noch höhere Werte gibt als den Frieden um jeden Preis, wird geflissentlich unterschlagen. Diese Haltung in der Gegenwart ist nicht von uns Deutschen entwickelt worden. Allenfalls treiben wir meinungslos im Kielwasser solcher Entschiedenheit einher. Mögen uns heute die Toten eines modernen Krieges als Opfer barer Sinnlosigkeit erscheinen oder nicht: Wir haben kein Recht, die Gefallenen früherer Kriege nur deshalb in die Katakomben des Verschweigens zu verbannen, weil wir mit ihrem Sterben in der Schlacht nicht zu Rande kommen. Eine Trauer, die den Toten der Kriege jeglichen Sinn ihres Einsatzes, ihres Mutes, ihres Leidens raubt, ist eine rückwärts gewandte Unmenschlichkeit und Entehrung. Daß wir die großen Schlachten der Geschichte, daß wir Skagerrak heute nicht so empfindungslos analysieren und darstellen wie die Militärs aller Zeiten bei ihren Sandkastenspielen, ist kaum der Erwähnung wert, weil es zu den Selbstverständlichkeiten der Humanität zählt. Doch auf diese Humanität, um kein schärferes Wort zu verwenden, besitzen die Gefallenen der Kriege dasselbe Recht. Und wegen dieses Rechts wurden einstmals die Ehrenmale für die Gefallenen errichtet, bei allen Völkern der Welt: Arlington, der Nationalfriedhof der Vereinigten Staaten bei Washington genauso wie das hochragende Marine-Ehrenmal Deutschlands in Laboe an der Kieler Förde — eingeweiht zwei Jahrzehnte nach der Schlacht am Skagerrak. Die eingefügten Bilder zeigen: Das Flottenflaggschiff „Friedrich der Große" in der Skagerrak-Seeeschlacht „Manövergeschwader der deutschen Flotte“, Druck nach einem Aquarell von Willy Stöwer, 1897. Großadmiral Alfred von Tirpitz (1849 – 1930): Die politische Leitung trieb eine gefährliche Politik. Als der Krieg da war, wurde die Flotte tunlichst entwertet…“ Admiral J.R. Jellicoe (1859 – 1935) brach die Schlacht ab. Admiral Reinh. Scheer (1863 – 1928) suchte die Entscheidung. Das deutsche Linienschiff „Thüringen“ im Gefecht; Aquarell von Claus Bergen, 1916.
Lustgarten und Exerzierplatz. Ein Streifzug durch 750 Jahre Berliner Geschichte, in: Rheinischer Merkur / Christ und Welt, Nr. 34, 21.08.1987. Lustgarten und Exerzierplatz Der Mann war zweifellos ein Schlitzohr, Johannes Kayser, Pfarrer zu Kleve; im Jahre 1698 notierte er das Anagramm: Berolinum - orbi lumen. Pfarrer Kayser hatte seinen Spaß an solchen Spielereien, aber nicht etwa deshalb, weil das Herzogtum Kleve seit 1614 zu Brandenburg gehörte oder weil er das Andenken des Großen Kurfürsten ehren wollte. Kayser war 1688 auf einer Dienstreise zum ersten Mal nach Berlin gekommen. Im gleichen Jahr verstarb der Große Kurfürst. Kayser hatte also dasjenige Berlin kennen und bewundern gelernt, dem Friedrich Wilhelm seinen Schriftzug eingegraben hatte. Wer heute, selbst anläßlich eines der vielen glanzvollen Spektakel dieses Jubiläumsjahres, Berlin als „Licht der Welt“ bezeichnet, riskiert bedenkliche Zweifel an seiner Urteilskraft. Das einzige Licht Berlins, das alle Welt kennt, ist das Schlaglicht, das die Schlagbäume an der Stadtgrenze und der Berliner Mauer auf die Situation der 750 Jahre alten Metropole werfen. Auch und gerade in diesem Jahr 1987, denn nichts beleuchtet die Situation Berlins so schonungslos, - und gleichzeitig auch so peinigend, denn diese Situation ist identisch mit der Lage Deutschlands und der Deutschen. Berlin war schließlich einmal unsere Hauptstadt, die einzige Hauptstadt, die wir jemals hatten. Eigentlich ist sie es noch immer. Eigentlich. Der ungeheure Aufwand für das Jubiläum dieses Jahres ist völlig gerechtfertigt; insbesondere die fidel-unterhaltsamen Veranstaltungen sind wichtig, damit niemand auf den Gedanken kommen könnte, daß es sich um eines der traurigsten Jubiläen handelt, das wir begehen können. Seit mehr als vier Jahrzehnten haben wir uns daran gewöhnt, das Absurde als normal zu betrachten. Am schnellsten erkennen wir es am Modell einer Verfremdung: Etwa an der Vorstellung eines Frankreichs, dem ein Drittel des Landes konfisziert, der Rest in Ost und West aufgeteilt und unter das Kuratel gegensätzlicher Großmächte gestellt ist. Paris läge dabei als Fremdkörper in einem dieser Gebiete, gleichfalls aufgeteilt und durch eine Mauer zerrissen. Ein König krönt sich selbst Dem Gallischen Hahn braucht die Galle bei diesem Gedankenmodell nicht überzulaufen, denn unsere Wirklichkeit ist für ihn nichts weiter als Phantasie. Sie geht ihm nicht unter die Haut, selbst wenn auf dem Papier der Dokumente, das so wenig kostet, etwas von der Gesamtverantwortung der vier Siegermächte des Jahres 1945 für Berlin und Deutschland „als Ganzes“ steht. Also: Wir feiern bei dem Berlin-Jubiläum den 750. Geburtstag unserer Hauptstadt, die uns abhanden gekommen ist, - nein: die uns weggenommen wurde. Wer nennt die Namen unserer Widersacher und ebenso jener unserer mutmaßlichen Freunde, die darüber noch immer Genugtuung empfinden und deshalb großmütig je nach dem herrschenden Klima publikumswirksame Gelübde ablegen, daß sie „fest zu Berlin stehen, weil ihre Präsenz keine Bürde, sondern heilige Pflicht“ sei, oder sich zu der bewunderungswürdigen, ja historischen Geste verstehen, die Tour de France 87 in Berlin-West starten lassen. Menschliches Leben läßt sich auf Berliner Boden bis in die Altsteinzeit aufspüren. So betagt freilich ist Berlin noch nicht, auch wenn in dieser Stadt heute so manches steinzeitlich wirkt, künstlich erzeugt durch den Aberwitz eines Oktroi, das seit vierzig Jahren darum bemüht ist, sich mit der Toga staatsmännischer Weisheit zu umgeben. Siebenhundertfünfzig Jahre Geschichte Berlins, über einige Etappen hinweg: Das ist kein Militärmarsch vom Zuschnitt des Hohenfriedbergers, auch kein Potpourri ä la Paul Lincke, kein Medley, das in dem Bekenntnis eines US-Präsidenten gipfelt, auch er sei ein Berliner, ein Credo, das zur Zeit jedem Offiziellen deshalb so gut ansteht, weil es nicht nur nichtssagend ist, sondern auch absolut unverbindlich - gottlob. So wie sich das für eine alte Stadt gehört, ist das Gründungsjahr fiktiv. Das Brüderpaar der Markgrafen Johann I. und Otto III. von Brandenburg beschloß zwischen den Jahren 1230 und 1240 wegen des rasch steigenden Handels, nördlich der Spree eine Stadt zu gründen. Genaugenommen waren es zwei Städte: Cölln wird 1237 erstmals in einem Dokument erwähnt. 1244 erscheint in einem Dokument der Name des Pfarrers Symeon, der schon in der Urkunde von 1237 genannt wird, als Probst von Berlin. Cölln-Berlin also, die beiden Gemeinden sind im 13. Jahrhundert aktenkundig, im Jahre 1307 werden sie Doppelstadt. Schon damals besaß sie fünf Tore, in deren Namen bis heute typisch Berlinerisches anklingt: Stralauer Tor und Georgentor, sowie das Spandauer, Teltower und Köpenicker Tor. Cölln – Berlin erhielt Magdeburger Stadtrecht. Die wirtschaftliche Entwicklung verlief rapide, gegen Ende des Jahrhunderts war Berlin bereits ein Zentrum des Handels und des Gewerbes, folgerichtig trat die Stadt im 14. Jahrhundert in die Hanse ein, die damals ihre Blütezeit erreicht hatte. Den erhofften Schutz durch den mächtigen Kaufmannsbund erhielt Berlin nicht. Und so wurde dieses Jahrhundert politisch für Berlin eine Phase der Wirren, doch der Aufstieg ließ sich dadurch nicht bremsen. Berlin reüssierte zur wichtigsten Stadt der Mark. Mag sein, daß sich hier bereits etwas von der typischen Berliner Intelligenz und Unbeirrbarkeit äußerte, die sich kaum jemals von den politischen Wechselfällen inkommodieren ließ. Um 1400 dehnte sich Berlin über ein Gebiet von 140 Quadratkilometern, umfaßte also mehr als ein Drittel des heutigen Berlin-Ost. Auch unter Friedrich I., der 1415 zum Kurfürsten erhoben wurde, setzte sich die Entwicklung Berlins zu einer Wirtschaftsmacht fort. Nach der Übernahme der Regentschaft durch Friedrich II. im Jahre 1437 kam es zu bürgerkriegsähnlichen Zwisten, und nach einem Ausgleich zwischen Bürgertum und Aristokratie erhob Kurfürst Johann Cicero im Jahre 1488 Berlin zur Residenzstadt. Worin unterscheidet sich die Stadtgeschichte Berlins bis zu diesem Zeitpunkt von anderen? Gibt es etwas spezifisch Berlinerisches schon damals? Allenfalls, daß selbst die Einbuße der Handelsprivilegien während der Auseinandersetzung mit dem Kurfürsten den Elan der Berliner nicht brechen konnte. Innerhalb eines Jahrhunderts verdoppelte sich die Einwohnerzahl. Als die Reformation 1539 eingeführt wurde, zählte Berlin 11 000 Einwohner. Kaum anderes ist von der Zeit des Dreißigjährigen Krieges zu sagen: So sehr die Stadt zu leiden hatte unter den Besatzungen und Plünderungen der schwedischen und kaiserlichen Truppen, so sehr dasselbe von der Schwächlichkeit des Kurfürsten Georg Wilhelm gilt, der es vorzog, den Grausamkeiten des Krieges dadurch zu widerstehen, daß er ihnen auswich und in das sichere Königsberg zog, - das Rückgrat der Berliner selbst nahm keinen Schaden. Georg Wilhelm starb am 1. Dezember 1640. Sein Nachfolger, der zwanzigjährige Friedrich Wilhelm, seit seinem Sieg über die Schweden 1675 bei Fehrbellin der Große Kurfürst genannt, zog erst drei Jahre später, 1643, in Berlin ein. Die Residenz befand sich in einem katastrophalen Zustand, die Einwohnerzahl war während des Dreißigjährigen Krieges um 40 Prozent gesunken, jedes dritte Haus stand leer und verfiel. Friedrich Wilhelm begann mit einer unglaublichen Schnelligkeit den Wiederaufbau. Schloß, Lustgarten, Wehranlagen, Stadtgraben und Stadtmauer, die Esplanade „Unter den Linden", Leipziger Tor, Friedrichswerder, die Dorotheenstadt, Neu-Cölln - das sind einige Stichworte, die nicht etwa nur für die Baulust des Großen Kurfürsten stehen, sondern in denen sich auch der Wille absolutistischer Repräsentation in der Gestaltung der fürstlichen Residenz und dem Ausbau Berlins zu einer Festung äußert. Die Lasten, die den Bürgern aufgeladen wurden, waren in den ersten Jahren gewaltig, doch ebenso groß war der wirtschaftliche Aufschwung, der sich bald als Folge daraus ergab. Am 18. Januar 1701 setzte sich Kurfürst Friedrich III. in einer feierlichen Zeremonie mit eigenen Händen die Königskrone auf. Kaiser Leopold I. hatte dem Krönungswunsch Friedrichs teils achselzuckend, teils amüsiert zugestimmt. Ihm war die militärische Unterstützung Preußens wegen Frankreich im Spanischen Erbfolgekrieg wichtiger als die Eitelkeit des Hohenzollern. Die Selbstkrönung fand in Königsberg statt, und als König in Preußen kehrte Friedrich I. nach Berlin zurück; seine Residenz war jetzt zur Königsstadt geworden. Und nicht nur Überschwang, sondern auch ihr Realitätssinn ließ die Berliner jubeln, als Friedrich I. in Berlin einzog. Viele Freunde und noch mehr Gegner Preußens schüttelten den Kopf über die Ambitionen eines Herrschers, den sein Enkel Friedrich II. der Große ätzend kritisierte und der ihm bescheinigte, er sei alles in allem „groß im Kleinen und klein im Großen“ gewesen. Das mochte so sein, doch das änderte nichts an der Tatsache, daß die Verwandlung Preußens in ein Königreich eine außerordentliche Rangerhöhung bedeutete, - auch des Ranges von Berlin. Die neue Würde entsprach dem tatsächlichen Gewicht des Staates und seiner Metropole. Stolz und Erfolg des städtischen Bürgertums und genauso der Herrscher zeigen sich am deutlichsten in den Bauten. Architektur ist stets auch ein Politikum. Im Mittelalter wurde das in den Stadtkirchen sichtbar. Und die Fürsten des Absolutismus empfanden es als selbstverständlich, sich selbst in ihren Bauten zu repräsentieren. Deshalb kristallisierte der neue König an Berlin jene Einrichtungen, in denen sich traditionell die Selbsteinschätzung des Staates ausdrückte. In Berlin wurde 1796 die Akademie der Künste gegründet, vier Jahre später folgte, von Leibniz initiiert, die Akademie der Wissenschaften. Das verhalf einem Beflissenen zu der Inspiration, in einem Huldigungs-Gedicht dem König dafür zu danken, daß er Berlin in ein „Spree-Athen“ verwandelt habe. Allen voran schuf Andreas Schlüter, Hofbildhauer und Schloßbaumeister, diejenigen Bauten, die das neue Gesicht der Stadt Berlin formten und durch die sie auch architektonisch zu einer Königsstadt wurde. An der Spitze stand die Umgestaltung des Berliner Schlosses zum barocken Prunkbau, gefolgt vom Ausbau des Zeughauses, der Errichtung des Mittelteils von Schloß Charlottenburg, nicht zu vergessen die Masken der sterbenden Krieger und das Denkmal des Großen Kurfürsten, das in unserer Zeit von der Langen Brücke am Stadtschloß an der Spree in den Ehrenhof des Charlottenburger Schlosses gebracht wurde. Aufgrund der Toleranz des Großen Kurfürsten hatte gegen Ende des 17. Jahrhunderts aus Frankreich ein starker Zuzug von Hugenotten begonnen. Die gewerbliche Wirtschaft erhielt dadurch einen kräftigen Impuls. Allerdings trieben die exzessiven Bauten Friedrichs I. Berlin an den Rand des Bankrotts. Der König starb 1713, er hinterließ seinem Nachfolger, dem Soldatenkönig, ein Preußen mit völlig zerrütteten Finanzen und mit einer der schönsten Hauptstädte Europas. Berlins Einwohnerzahl war innerhalb von knapp vier Jahrzehnten von 12.000 auf 61.000 hochgeschnellt. Der enthemmten Bauwut seines Vaters setzte Friedrich Wilhelm I. eine manische Sparsamkeit entgegen, doch an Bauwut litt auch er. Zeichen dafür war nicht nur seine Verwandlung des Lustgartens in einen Exerzierplatz, oder daß er aus den Berliner Gartenanlagen, die von dem berühmtesten Gartenkünstler der Zeit, von Le Notre stammten, alle Blumen herausriß und sie durch Kohlpflanzungen ersetzte, sondern daß er Tausende von Bürgerhäusern und eine neue Stadtmauer errichten ließ. Die Stadt verwandelte sich unter dem Soldatenkönig in eine Garnisonsstadt, die Wirtschaft verkümmerte. Der Soldatenkönig entließ schließlich Berlin aus dem Kantonalsystem. Weil von diesem Moment an kein Berliner mehr zum Militärdienst mußte, zog die Stadt plötzlich wie ein gewaltiger Magnet Handwerker und Kaufleute an. Die Einwohnerzahl wuchs von 61.000 im Jahr 1712 auf mehr als 90.000 im Jahr 1740. Die nachhaltigsten Verbesserungen führte der König in der inneren Verwaltung durch, seit 1722 koordinierte sein Generaldirektorium die Wirtschafts- und Finanz-, sowie die Militärpolitik. 1726 wurde die später so berühmte Charite nicht nur öffentliches Krankenhaus, sondern auch ärztliche Hochschule. Auch Friedrich der Große verlieh Berlin ein neues Gesicht. Sofort nach seinem Regierungsantritt 1740 ernannte er seinen Freund, den Maler und Architekt Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff, zum Oberintendanten der königlichen Schlösser und Gärten. In den dreizehn Jahren bis zu seinem Tod gab Knobelsdorff Berlin durch seine Bauten das Gepräge eines feingliedrigen Klassizismus. Er war so charakteristisch, daß er sogar zum Merkmal einer spezifisch friederzianischen Baukunst wurde. Für das Wirken Knobelsdorffs genügt die Summierung einiger Namen: Erweiterung des Schlößchens Monbijou und Charlottenburg, Berliner Opernhaus, Stadtschloß Potsdam, Schloß Sanssouci nach einem Entwurf des Königs, Verwandlung des Tiergartens in einen Landschaftspark. Das Jubiläumsjahr 1987 hat auch dem Typ des Berliners mehr als genug Gelegenheit gegeben, sich zu präsentieren. Was das Typische des Berliners ist, läßt sich einigermaßen genau umschreiben. Es ist nicht so sehr der Witz im allgemeinen, sondern der besondere Mutterwitz, der gutmütige Spott, die Schnoddrigkeit, das Fixe, die unerhörte Beweglichkeit des Geistes, die Treffsicherheit der Charakterisierung, sei es, daß der Berliner schneller als jeder andere auf der Welt das Pathos auf den Asphalt herabholt, sei es, daß er die Substanz der Nüchternheit durch Ironie freilegt. Charakteristisch ist es schon, daß sich das typisch Berlinerische auch mit der Sprache des Berliners deckt. Goethe hat ihn etwas hilflos als den „verwegenen Menschenschlag“ charakterisiert, demgegenüber man selbst Haare auf den Zähnen haben müsse. Was sich „Berliner Schnauze“ nennt, ist mehr als Mundwerk. Und sollte sich diese Stadt in Gefahr sehen, einmal von Selbstmitleid übermannt zu werden, rettet sie sich dadurch, daß sie den professionellen Schreibern ihre Gefühle zur literarischen Verdauung überläßt. Dabei gilt für alle Versuche einer Charakterisierung des Berliners die Feststellung, daß auf diesen Menschenschlag im Grunde nichts Eindeutiges zutrifft. Nicht einmal das. Man muß es nicht unbedingt für typisch halten, aber zweifellos ist es auch kein Zufall, daß Berlin im 18. Jahrhundert das Zentrum der deutschen Aufklärung wurde. Den Prototyp dafür bildete Friedrich Nicolai, der erfolgreichste Verkünder der Religion des Rationalismus, ebenso bewundert von den Lesern wie von einem Heer der Kritiker geschmäht wegen seiner vernünftlerischen Plattheit. Freilich ist Nicolai nicht charakteristisch für Berlin, sondern umgekehrt: Es ist charakteristisch, daß in dieser Zeit und seit dieser Zeit Berlin der Ausgangs- und Mittelpunkt für alle neuen Ideen und Kulturimpulse wurde, und dies trotz der Vielzahl der Residenzen in den deutschen Territorialstaaten. In den Berliner Salons, die im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts entstanden, fand sich fast alles zusammen, was Rang und Namen hatte: Chodowiecki, Henriette Hertz, die Gebrüder Humboldt, Theodor Körner, Moses Mendelssohn, Schadow, die beiden Schlegel, Rahel Levin-Varnhagen. Und ebenso sind die Namen zu nennen von Achim von Arnim, Brentano, Fouqué, E.T.A. Hoffmann, Kleist, Schinkel, Schleiermacher. In diese Tradition ordnet sich eine fast endlose Kette von Persönlichkeiten und neuen Impulsen ein, die Berliner Romantik gehört genauso dazu wie alles, was zum Umkreis der Preußischen Reformen zählt, zur Gründung der Berliner Universität und ihren ersten Namen: Fichte, Hegel, Alexander von Humboldt, später Arndt, Ranke, die Brüder Grimm, Niebuhr, Schelling, Wilhelm Dilthey, Theodor Mommsen. Deutschlands einzige Hauptstadt Wer sich dazu versteigt, mit Berlin etliche Gipfelpunkte der Philosophie und Literatur zu verbinden, darf das Gegengewicht des sozialen Elends nicht vergessen, das dank der Mietskasernen, die Friedrich der Große nach dem Siebenjährigen Krieg errichten ließ, in Berlin einen unerschöpflichen Nährboden fand und noch Käthe Kollwitz genauso inspirierte wie Heinrich Zille und Flutwellen der Sozialkritik auslöste. Die anderen deutschen Großstätte kopierten während der Industrialisierung die Berliner Mietskasernen schneller als den Berliner Geist, und zwar nicht nur deshalb, weil sich „Geist“ so schwer kopieren läßt. Im 19. Jahrhundert wurden die Deutschen mit dem Wiener Kongreß, dem Deutschen Bund und der 48er-Revolution beschwert. Der schroffe Dualismus Österreich-Preußen wurde im Zeichen der Nationalstaatsbildung nach außen hin im Jahre 1866 zugunsten Preußens und des kleindeutschen Reiches entschieden. Bismarck hob dieses Reich 1871 aus der Taufe. Die Hauptstadt des neuen Deutschland konnte nur Berlin sein, der überkommene Gegensatz zur alten Kaiserstadt Wien erhielt dadurch eine besondere Färbung. Daß Berlin die einzige Hauptstadt war, die Deutschland jemals besaß, und ebenso die einzige Stadt bleibt, die dereinst wiederum Hauptstadt Deutschlands sein wird, das ergab und ergibt sich aus der Logik der Historie und dem, was sich von ihr als Geschick manifestiert. Diese Tatsache verdammt alle Wehleidigkeiten, all die Kläglichkeit der Rechtfertigungen des Status quo, alle Resignation zur Belanglosigkeit. Daß Berlin mehr ist als ein Requisit von Jubiläums-Sentimentalitäten weiß niemand so gut wie die Berliner, und ebenso wissen sie, daß sie nach wie vor in der Hauptstadt Deutschlands wohnen, - dem großen Konrad Adenauer zum Trotz, der am 12. Dezember 1946 kategorisch erklärt hatte: „Berlin darf nie wieder Deutschlands Hauptstadt werden. Wer Berlin zur neuen Hauptstadt macht, schafft geistig ein neues Preußen.“ Was gibt es ausschließlich in Berlin? Die Berliner Weiße, die Molle mit Schuß? Oder nur noch das, was Berlin mal war? Die Avus, die Inflation, die Goldenen Zwanziger, die ihr Bewußtsein erst nach 45 entdeckten und etliche helle Köpfe schon nach 1933? Oder gibt es vor allem die Mauer ausschließlich in Berlin? Die Mauer ist vorübergehend. Die eiserne Lady Thatcher hätte dazu anläßlich ihres Jubiläums-Pflichtbesuchs vor der Berliner Mauer nicht einmal die weihevollen Worte finden müssen, daß „unsere Gebete und Träume auf ihren Abriß gerichtet“ sind. Tatsächlich wird sie von anderem träumen, und sie tut recht daran. Denn Berlin hat sein eigenes Selbstgefühl. Ein Gutteil seiner Gesichtszüge, die bis heute auch Nichtberlinern vertraut sind, stammen aus den Zwanziger Jahren. Welche Assoziationen wecken noch immer solche Namen und Worte wie Aschinger, Benn, Brecht, Marlene Dietrich, Döblin, Heinrich George, George Grosz, Willy Haas, Kästner, Kerr, Walter und Willy Kollo, Max Reinhardt, Romanisches Cafe, Ringelnatz, Sternheim, Grete Weiser, die UFA und dazu der politische Bürgerkrieg, in der jede Partei der anderen an die Gurgel ging, so wie der Staatsdenker Hobbes den Menschen charakterisiert hatte: Homo homini lupus. Und Berlin heute? Immer noch eine Stadt der Superlative: 67,4 Prozent der Berliner Drogensüchtigen haben Aids, keine Stadt der Welt keine Stadt der Welt ist stärker auf Subventionskrücken angewiesen, keine ist so zerrissen, verletzt, demoliert und intakt wie Berlin, keine so überaltert und vital, nirgends ballt sich soviel Hoffnungslosigkeit und Elan des „Trotzdem“ auf einmal zusammen, nirgends lebt das „andere Preußen“ stärker als hier und die Reste desselben Preußentums in literarischem Parfüm genauso. Keine Totenstadt ist so lebendig, nirgends ist das Schrebergartenmilieu und die Ku'damm – Mondäne ausgeprägter, und trotz aller Fortschritte der Chemie gibt es noch immer dieselbe Berliner Luft, das Produkt der Wälder und Seen in der Umgebung, der flachen Landschaft, die dem Wind nichts entgegensetzt, um ein bestimmtes Aroma zu liefern. Der Status quo der „Berliner Luft“ ist unsere Zuversicht. Wer dem anderen, dem politischen Status quo das Wort redet, selbst jenem einer so gebrochenen, gebeutelten, zerstörten, tranchierten, dynamischen, verwüsteten und unverwüstlichen Stadt wie Berlin, der redet Unsinn. Berlin ist so alt wie der Bamberger Dom, Berlin ist größer als die Summe seines Territoriums West mit 481 Quadratkilometer und Ost mit 403 Quadratkilometer. „Denkste“, würde ein Berliner dazu sagen, denn das Flächenmäßige allein macht weder einen Staat noch eine Stadt. Vor allem nicht Berlin. Und so bleibt dieses Berlin für alle Zukunft auch für uns, am Ende des Jahrhunderts, was es in den zwanziger Jahren war: diejenige Stadt die „bestanden“ werden mußte, an der Maß zu nehmen ist, das Regulativ, wie Gottfried Benn festgestellt hat, „aus dem man sich Impulse holte, denn Berlin war vor allem etwas, vor dem man sich generieren konnte“
Widerwillig beugte er sich unter die Krone des Reichs, Vom Kartätschenprinzen zum populären Pater patriae: Vor hundert Jahren starb Wilhelm I., Preußens letzter König und Deutschlands erster Kaiser, in: Rheinischer Merkur / Christ und Welt, Nr. 10, 04.03.1988. Widerwillig beugte er sich unter die Krone des Reichs Einmal in seinem Leben spielte er sogar die Rolle eines Abgeordneten der Preußischen Nationalversammlung in Berlin. Prinz Wilhelm, der jüngere Bruder König Friedrich Wilhelms IV., war Thronfolger. Während der Revolution des Jahres 1848 wollte er mit den Aufständischen kurzen Prozeß machen. Der König hatte dafür wenig Sinn, er befahl, die Truppen aus Berlin abzuziehen. Prinz Wilhelm schrie ihn an: „Bisher habe ich wohl gewußt, daß du ein Schwätzer, nicht aber, daß du eine Memme bist! Dir kann man mit Ehren nicht mehr dienen!“ In diesen Märztagen galt Wilhelm, der einundfünfzigjährige „Kartätschenprinz", als Verkörperung der Gegenrevolution. Ultimativ riet ihm der König, Berlin zu verlassen, befahl ihm, nach London zu gehen. Wilhelm respektierte das Wort des Herrschers, vor allem deshalb, um das Ansehen der Monarchie nicht durch den offenen Gegensatz zwischen König und Thronfolger zu kompromittieren: „Ich murre nicht, ich widersetze mich nicht und gehorche.“ Doch der entschlossene, von keinem Wankelmut beeinträchtigte Prinz durchlitt in diesem Zwangsexil die schlimmsten Tage seines Lebens: „Ich bin wie vernichtet! Gar keine Aussicht in die Zukunft!" Doch der Realist und Pragmatist faßte sich schnell. Preußen, wie es bis 1848 bestanden hatte, mochte zwar untergegangen sein, doch war er entschlossen, „wahr und wahrhaftig dem neuen Preußen meine Kräfte ebenso willig zu verleihen, wie dem alten! Was hinter uns liegt, ist vorüber.“ Um der Passivität in London schleunigst zu entkommen, betrieb er seine legale Rückkehr nach Berlin. Er ließ sich von einer Gruppe konservativer Freunde in der Provinz Posen zum Abgeordneten des Kreises Wirsitz in die Preußische Nationalversammlung wählen. Zwei Tage nach seiner Rückkehr aus London, am 8. Juni 1848, erschien er in Generalsuniform in der Sitzung, bat um das Wort, hielt eine kurze Rede über den „hohen Beruf“ der Preußischen Nationalversammlung, legte ein Bekenntnis zur konstitutionellen Monarchie ab und verließ den Saal. Von diesem Gastspiel des späteren Königs und deutschen Kaisers als Abgeordneter ist kaum viel mehr geblieben als die Erinnerung an eine Kuriosität. Trotzdem ist sowohl die altpreußische Entschiedenheit, mit der Wilhelm während der Revolution die Republikanischen Forderungen abwürgen wollte, als auch sein Akzeptieren der unwiderruflichen Veränderungen typisch für ihn - jedenfalls genauso typisch wie die Aura der greisen Vaterfigur, in die er verwandelt wurde, nachdem ihn die deutschen Fürsten 1871 zum ersten Kaiser des Deutschen Reiches gewählt hatten. Die Armee wie ein Fels im Meer Da die Ehe König Friedrich Wilhelms IV. kinderlos geblieben war, bestimmte er schon frühzeitig seinen zwei Jahre jüngeren Bruder Wilhelm zum Thronfolger. Im Juni 1857 erlitt der König einen Schlaganfall, sein Zustand verschlechterte sich rapide, Wilhelm übernahm die Stellvertretung und am 7. Oktober 1858 die Regentschaft. Nach dem Tod des Bruders am 2. Januar 1861 wurde er König von Preußen. Der neue Herrscher warf das Steuer sofort herum. Er entließ das reaktionäre Ministerium des Grafen Otto von Manteuffel, er bildete die liberale Regierung der „Neuen Ära". Die hochgespannten Hoffnungen, die alle Liberalen auf ihn gesetzt hatten, zerschlugen sich freilich rasch. Als Soldat von Geblüt und hervorragender Fachmann auf militärischem Gebiet hatte Wilhelm I. seine eigenen Vorstellungen von dem, was der preußischen Armee frommte. Das Heer war des Königs ureigenstes Terrain. Schon in der Revolutionszeit konnte er zu Beginn des Jahres 1849 zufrieden feststellen: „Bis jetzt hat die Armee wie ein Fels im Meer gestanden und Preußens altes Geschick bekundet, daß die Armee sein Anker immer war, ist und bleibt.“ Als siebzehnjähriger Hauptmann hatte er an den Befreiungskriegen gegen Napoleon teilgenommen, 1825 wurde er Generalleutnant und erhielt das Gardekorps unterstellt. Im Sommer 1849 kommandierte er die 55 000 Mann starke Operationsarmee aus preußischen Truppen und einem Bundeskorps, die den letzten Aufstand der Märzrevolution in Baden und in der Pfalz niederschlug. Trotz dieser konterrevolutionären Vorgeschichte richteten sich in der Reaktionszeit zwischen 1848 und 1860 auf den Thronfolger wie auf einen Brennpunkt alle Hoffnungen der fortschrittlich Gesinnten. Grund dafür war nicht nur die Illusion, daß die Veränderung der Herrschaft, der Wechsel der Verhältnisse auch zwangsläufig eine Verbesserung bedeuten würde. Prinz Wilhelm war zum Militärgouverneur am Rhein und in Westfalen“ ernannt worden und lebte seit März 1850 mit seiner Familie im spätbarocken Schloß von Koblenz. Innerhalb weniger Monate sammelte sich um den Thronfolger und seine Gemahlin Augusta von Sachsen-Weimar ein Kreis von Persönlichkeiten, die fast ausnahmslos in kritischer Opposition zum Berliner Hof und der preußischen Regierung standen. Im wesentlichen wurde hier am Rhein einer liberalkonservativen Politik das Wort geredet - im Gegensatz zu der reaktionären Politik des Berliner Hofes. Diese Veränderung des Prinzen ist bemerkenswert. In der Märzrevolution galt der König zunächst als weicher Liberaler, Prinz Wilhelm dagegen als Wortführer der reaktionären Junker. Nunmehr aber redete Wilhelm beständig den unerläßlichen Reformen das Wort, während sich Friedrich Wilhelm IV. zufrieden im restaurierten Haus der monarchischen Gewalt einrichtete. Kein Wunder, daß Leopold von Gerlach, der Generaladjutant des Königs, den „Liberalismus“ des Prinzen von Preußen und seiner „Demokratenfamilie“ als das traurigste Zeichen der Zeit beklagte. Seiner Regierung der „Neuen Ära“ hatte Wilhelm die Devise mitgegeben, es sei „bessernde Hand an manches zu legen, langsam und besonnen“. Wie wenig damit auch für Preußens Stellung innerhalb des Deutschen Bundes und bei der brennenden Frage der Bundesreform auszukommen war, bekam der Herrscher bald zu spüren. Im Sommer 1860 hatte er in Baden-Baden den deutschen Fürsten versichert, „die Erfüllung der nationalen Aufgabe, die Sorge für die Integrität und Erhaltung Deutschlands“ werde bei ihm immer obenan stehen. Sobald sich aber in nationalen Regungen der Wille des Volkes äußerte, mahnte der König, immer „das Nationale von dem Revolutionären klar zu unterscheiden“. Weit dringlicher aber als die deutsche Frage war für Preußen zunächst die Notwendigkeit, das überständige Militärsystem zu modernisieren. Entscheidend dafür wurde die Denkschrift über die „Vaterländische Heeresreform“, die Generalmajor Albrecht von Roon im Auftrag seines Herrschers ausgearbeitet und im Juni 1858 vorgelegt hatte. Sie wurde zur Grundlage der preußischen Heeresreorganisation. Die Kernpunkte waren: dreijährige Dienstzeit, Vermehrung des stehenden Heeres und engere Verbindung der Landwehr mit der Linienarmee. Das Abgeordnetenhaus hatte dem Projekt zunächst als einem Provisorium zugestimmt, doch die Entfremdung zwischen dem Herrscher und den Fortschrittskreisen und ebenso seinem liberalen Ministerium wuchs rapide. Schon im Mai 1860 schrieb er seiner Gemahlin: „Ich habe die parlamentarische Geschichte bis an den Hals.“ Zu Beginn des Jahres 1862 stand fest, daß weder das neue Wehrgesetz noch der Etat vom Parlament gebilligt würden. Daraufhin löste der König am 11. März 1862 das Abgeordnetenhaus auf. Er hatte sich endgültig davon überzeugt, daß der Kurs der Neuen Ära „mich ins Unglück gestürzt hat“. Der König weigerte sich, vor dem Parlament zurückzuweichen, weil „ich mit mir und meiner ganzen Vergangenheit nicht in Widerspruch geraten darf“. Doch Wilhelm I. fand keinen Mann, der es als verantwortlicher Minister mit dem Landtag aufnahm, um ohne Konzessionen das politische Programm des Königs durchzusetzen. In seiner Not blieb ihm nichts anderes übrig, als dem Rat seines Kriegsministers Roon zu folgen und den als stockkonservativ verschrienen Bismarck zu berufen. Der altmärkische Junker, damals preußischer Gesandter in Paris, verbürgte sich in einem ersten Gespräch mit dem König, die Heeresvorlage durchzusetzen und dabei notfalls „auch gegen die Majorität des Landtags und deren Beschlüsse“ zu handeln. Mit der Berufung Bismarcks hat Wilhelm I. seinen Paladin gefunden. Und Bismarck seinerseits, bis dahin irgendeiner unter den vielen anderen versierten Diplomaten, die Gott und die Welt kannten, die aber selbst der Welt kaum bekannt waren, taucht urplötzlich auf der politischen Großbühne auf, setzt das laufende Programm ab und beginnt sein eigenes Ein-Mann-Schauspiel aufzuführen. Die Vorstellung des Regisseurs und Akteurs Bismarck unter der Intendanz von Wilhelm I. dauert fast drei Jahrzehnte, im Parkett sitzt ganz Europa, und die Zuschauer kommen kaum dazu, Atem zu holen. Das Drama, das Bismarck inszeniert, wird zunächst von ultrakonservativer Musik untermalt, doch schon nach kurzer Zeit ist sie vollständig übertönt vom weithin hallenden Männergesang der nationalen Deutschen. Seit dem Herbst 1862 steht König Wilhelm I. in der gängigen Geschichtsschreibung ganz im Schatten Bismarcks. Dabei wird übersehen, daß Bismarck selbst auf den König womöglich noch weit stärker angewiesen war als Wilhelm I. auf seinen verantwortlichen Minister. Entscheidend war zunächst ihre völlige Übereinstimmung in den grundlegenden politischen Fragen. Daran änderte sich nichts durch die Jahre und trotz der vielen Differenzen, die Bismarck mit seinem Herrn auszutragen hatte. Schon in der Beurteilung des Heereskonflikts sind sich König und Minister einig: Es handelt sich dabei um einen Prinzipienkampf zwischen Krone und Parlament, deshalb ist die Heeresvorlage nur der Anlaß, nicht der Gegenstand des Konflikts. So billigt es Wilhelm I., daß Bismarck den Landtag schließt und vier Jahre lang ohne Budget die Regierung führt. Er billigt den Kurs Bismarcks, der auf eine gewaltsame Lösung des Gegensatzes zwischen Preußen und Österreich im Deutschen Bund hinausläuft, also auf den Bruderkrieg des Jahres 1866. Nach dem Sieg bei Königgrätz am 3. Juli 1866 kommt es zum heftigsten Zusammenstoß zwischen dem König und Bismarck. Österreich soll weitestgehend geschont werden - den Grund kann der König bei den Verhandlungen in Nikolsburg nicht gleich begreifen: „Vor den Toren von Wien sehe ich mich zu meinem Schmerz gezwungen, nach so glänzenden Siegen der Armee in diesen sauren Apfel zu beißen und einen schmachvollen Frieden anzunehmen.“ Bismarck bekommt einen Weinkrampf, der Kronprinz vermittelt schließlich, so daß einem der maßvollsten Friedensschlüsse der jüngeren Geschichte nichts mehr im Wege steht. Die Versöhnung zwischen König und Minister ist nach der Ratifikation der Friedensbedingungen genauso intensiv wie das Zerwürfnis vorher. Kriegsminister Roon notiert: „Der König sprang auf, umarmte und küßte dankend und weinend, mit viel beweglichen Worten zuerst Bismarck, dann mich und Moltke.“ Preußens Sieg bei Königgrätz wurde zum Grundstein der nationalen Einigung der Deutschen. Zum Richtfest verhalf der deutsch-französische Krieg der Jahre 1870/71. Die Voraussetzung dafür waren die Schutz- und Trutzbündnisse, welche die süddeutschen Staaten mit dem Norddeutschen Bund geschlossen hatten. Der König von Preußen und Oberbefehlshaber der preußischen Armee erhielt im Fall eines Krieges auch den Oberbefehl über die süddeutschen Truppen. Als sich wegen der spanischen Thronkandidatur eines Hohenzollern die französische Regierung in eine höchst willkommene Erregung steigert und aufgrund der Emser Depesche, die Bismarck raffiniert zu einer Provokation zusammenstreicht und so veröffentlicht, Preußen den Krieg erklärt, kommt es zu einem Dammbruch in der europäischen Politik. König Wilhelm I. hatte in Bad Ems den französischen Botschafter zwar bestimmt, aber nicht unkonziliant behandelt. Der Wortlaut der Emser Depesche in der veröffentlichten Form wirkt tatsächlich so, wie es Bismarck prophezeit hat: „Wie ein rotes Tuch auf den gallischen Stier.“ Als Wilhelm I. die redigierte Depesche liest, sagt er trocken: „Das ist der Krieg!“ Die Begeisterung der deutschen Öffentlichkeit über dieses Telegramm ist in Norddeutschland genauso groß wie im Süden. Als Wilhelm I. nach Berlin zurückfährt, wird sein Zug auf der ganzen Strecke umjubelt. Zu seiner Gemahlin meint er: „Ich habe so etwas nicht für möglich gehalten. Mich erfüllt eine komplette Angst vor diesem Enthusiasmus.“ Der preußische König spürt nur zu gut, was hier zum Ausdruck kommt. Auf die kürzeste Formel bringt es der bayerische Ministerpräsident. Da jetzt die Militärverträge in Kraft treten, erklärt Graf von Bray-Steinburg - ein entschiedener Bismarck-Gegner - nach der Emser Depesche lapidar: „Von hier ab ändert sich die Natur der Sache, die spanische Kandidatur verschwindet, die deutsche Frage beginnt.“ Der Krieg mit Frankreich dauerte acht Monate. Er war das militärische Rankenwerk um diese deutsche Frage. Schon während der Belagerung von Paris, die im September 1870 begann, setzten intensive Verhandlungen mit den Süddeutschen Staaten ein. Formal handelte es sich um einen Beitritt des Südens zum Norddeutschen Bund. Das neue Gebilde mußte aber auch neu benannt werden. Für Bismarck kam nur der Name „Deutsches Reich“ in Frage, sein Oberhaupt konnte nur Wilhelm I. sein, mit dem Titel „Kaiser“. Das aber lehnte Wilhelm I. halsstarrig ab. Der Mann, der seit 1848 mehr Rückgrat gezeigt hatte als jeder andere deutsche Fürst, empfand diese Titulatur als eine Degradierung seines angestammten preußischen Königstitels. Ein Kaiser war das Haupt des „Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation" gewesen. Der neue Kaisertitel stellte für ihn nichts anderes dar als eine Konstruktion, die man auf Diplomatentischen ausgeheckt hatte. Ein Monument der alten festen Werte So wie bei seinem Konflikt mit den preußischen Abgeordneten spielte er auch jetzt mit dem Gedanken des Rücktritts. Wilhelm I., der nach der Reichsgründung weithin als eine Inkarnation der väterlich-geduldigen Rechtschaffenheit in der Maske des deutschen Kaisers galt, besaß unendlich mehr Charakter als die meisten deutschen Politiker jener Tage. Politiker, die fast ausnahmslos das Wort im Frankfurter Paulskirchenparlament geführt hatten und die nunmehr der Reichsgründung von oben und von Gnaden Bismarcks mit einem Enthusiasmus applaudierten, als ginge es darum, sich gegenseitig auf die Schultern zu klopfen. Demgegenüber wirkt der vierundsiebzigjährige König von Preußen schon jetzt wie ein Monument der alten festen Werte. Schon 1847, kurz vor der deutschen Revolution, hatte er gemeint, daß es nur darauf ankomme, zur rechten Zeit Institutionen des Fortschritts Raum zu geben: „Fortleugnen kann kein Mensch auf Erden die Zeitbedürfnisse, sie ignorieren wollen, heißt blind sein wollen; die Aufgabe ist also, ihnen einen Abfluß in einem gesicherten Bett zu geben. Darin liegt die ganze Staatskunst: das Nötige erkennen und anwenden.“ An dieser tiefen Überzeugung Wilhelms I. änderte sich auch 1870/71 nichts. Hätten ihm damals die Parlamentarier so wie seinem Bruder Friedrich Wilhelm IV. die Krone und den Titel eines Kaisers angetragen, er hätte sie höhnisch nach Hause geschickt. Wilhelm I. hoffte, daß sich auch keiner der Fürsten dazu bereitfinden würde. Doch Bismarck konnte den bayerischen König Ludwig II., den Repräsentanten des Hauses Wittelsbach, von der Notwendigkeit überzeugen, dem Preußenkönig die Kaiserkrone anzutragen. Damit war die letzte Chance der Ablehnung dahin, der König war verzweifelt, „ganz außer sich vor Unwillen und wie geknickt“. Noch am 17. Januar, einen Tag vor der Kaiserproklamation in Versailles, die bewußt auf das Datum des preußischen Krönungstages und damit auf den Gründungstag des preußischen Staates gelegt wurde, brach er aus: „Ich mache mir nicht ein Haar breit daraus und halte zu Preußen.“ Vor Bismarck verlor er die Fassung, der alte Herr begann zu schluchzen: „Morgen ist der unglücklichste Tag meines Lebens. Da tragen wir das preußische Königtum zu Grabe, und daran sind Sie, Graf Bismarck, schuld!“ An diesem Januartag des Jahres 1871 ging für die große Mehrheit des deutschen Volkes der uralte Kaisertraum in Erfüllung. Seine mythische Übermacht ließ die Tatsache zu einer Belanglosigkeit schrumpfen, daß diejenige Persönlichkeit, in der er Gestalt annahm, sich niemals aus vollem Herzen als deutscher Kaiser empfand, daß Wilhelm I. für sich selbst immer nur König von Preußen blieb. Unbeschadet dessen, daß jetzt die großen Nationalmonumente entstanden, das Niederwald-Denkmal hoch über dem Rhein, auf dem Kyffhäuser, das Monument des „Heldenkaisers“ in Berlin, das Reiterstandbild am Deutschen Eck in Koblenz, errichtet ein Jahrzehnt nach seinem Tod vor genau einhundert Jahren. Im Mittelpunkt stand der Monarch In diesen Skulpturen wiederholt sich, was in Versailles 1871 niemand geahnt und Wilhelm nicht einmal befürchtet hatte. Im Mittelpunkt dieses Deutschen Reiches, dem die Verlegenheitslösung der Frankfurter Paulskirche von 1848 zugrunde lag, nämlich die kleindeutsche Verfassung, stand nicht die deutsche Nation und ebensowenig das deutsche Volk. Im Mittelpunkt stand der Monarch, jener König also, der immer nur ein Preuße gewesen war und der für die „Nationalität“ kaum viel mehr übrig gehabt hatte als sein treuester Diener, der reaktionäre Krautjunker Bismarck, der 1862 achselzuckend bemerkte: „Für die deutsche Nationalität habe ich gar keinen Sinn, mir ist ein Krieg gegen den König von Bayern oder Hannover gerade so viel wie gegen Frankreich.“ Wilhelm I. war zum deutschen Kaiser geworden, ohne es zu wollen. Er sah sich von den Verhältnissen in eine Rolle gedrängt, die er nicht billigte, die er aber auch nicht ausschlagen konnte. Dies zeichnete ihm den Weg vor durch die folgenden beiden Jahrzehnte. Schon kurz nach 1871 setzte ein rascher körperlicher Abbau ein, 1873 erlitt der Kaiser einen ersten Schlaganfall. Die Erholung war nur kurzfristig, Wilhelm I. wurde geistig zunehmend schwerfällig, immer vergeßlicher, sperrte sich allmählich völlig gegen neue Auffassungen, nicht zuletzt auch bedingt durch die wachsende Schwerhörigkeit. All das änderte nichts daran, daß der Kaiser zur Symbol- und Integrationsfigur des jungen Deutschen Reiches wurde, das gerade um der kaum erträglichen Widersprüche willen, die zu seiner Gründung gehörten, auf einen Mann wie Wilhelm I. angewiesen war. Allein dieser Monarch war in der Lage, ohne Anmaßung und mit fragloser Kompetenz an der Spitze dieses neuen Staates von 1871 zu stehen - gerade weil er nicht wie Bismarck politisches Übermaß besaß, sondern sich als einfacher, von Natur aus nicht übermäßig begnadeter, jedoch mit starkem Charakter versehener Mensch durch die historischen Gegensätzlichkeiten hatte ringen müssen. Und nicht zuletzt auch deshalb, weil er tagaus, tagein nach den altpreußischen Tugenden lebte: sparsam, fromm, nüchtern, eine Verkörperung des Mottos: „Im Kleinsten treu!“ Das Deutschland dieses Kaisers war der einzige Nationalstaat, den wir jemals hatten, es war der Staat aller Deutschen, die von der deutschen Nation in einer politischen Verfassung geträumt hatten, es war ebenso der Staat derjenigen, die ihn schmähten, haßten, bekämpften. Der erste deutsche Kaiser, der zugleich der letzte wirkliche König von Preußen war, repräsentierte gerade durch seine Distanz dieses neu geschaffene Deutschland weit besser als Bismarck. Der Reichsgründer wurde in scheuem Respekt verehrt. Wilhelm I. aber wurde als „unser alter Kaiser“ geliebt, weil sich in ihm selbst ein Teil jener Erschütterungen abgespielt hatte, die wesentlich auch zum Geburtsakt von Deutschland gehörten. Jenem Land, das während der noch folgenden zwei Jahrzehnte der Regierung Wilhelms I. zum Vaterland der Deutschen wurde: ein in Mißmut und Verwunderung, Trauer und Verzweiflung, aber nach Maßgabe des irdisch Möglichen auch geliebtes Vaterland. |
|
[Home] [Bücher] [Herausgeber] [Erhältliche Titel] [Artikel] [Kontakt] |

 WELT: Damit sind wir ja schon bei der größten der drei deutschen Republiken.
WELT: Damit sind wir ja schon bei der größten der drei deutschen Republiken.

 Aber ehe ich einige davon aufzähle sei noch mal die für mich selbstverständliche Feststellung getroffen: An der Tatsache der millionenfachen Judenmorde und an den damit verbundenen Greueln gibt es für mich keinen Zweifel.
Aber ehe ich einige davon aufzähle sei noch mal die für mich selbstverständliche Feststellung getroffen: An der Tatsache der millionenfachen Judenmorde und an den damit verbundenen Greueln gibt es für mich keinen Zweifel.
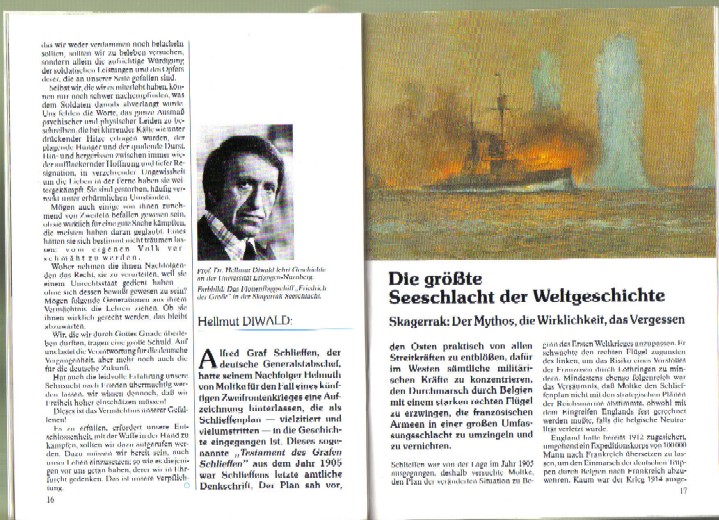
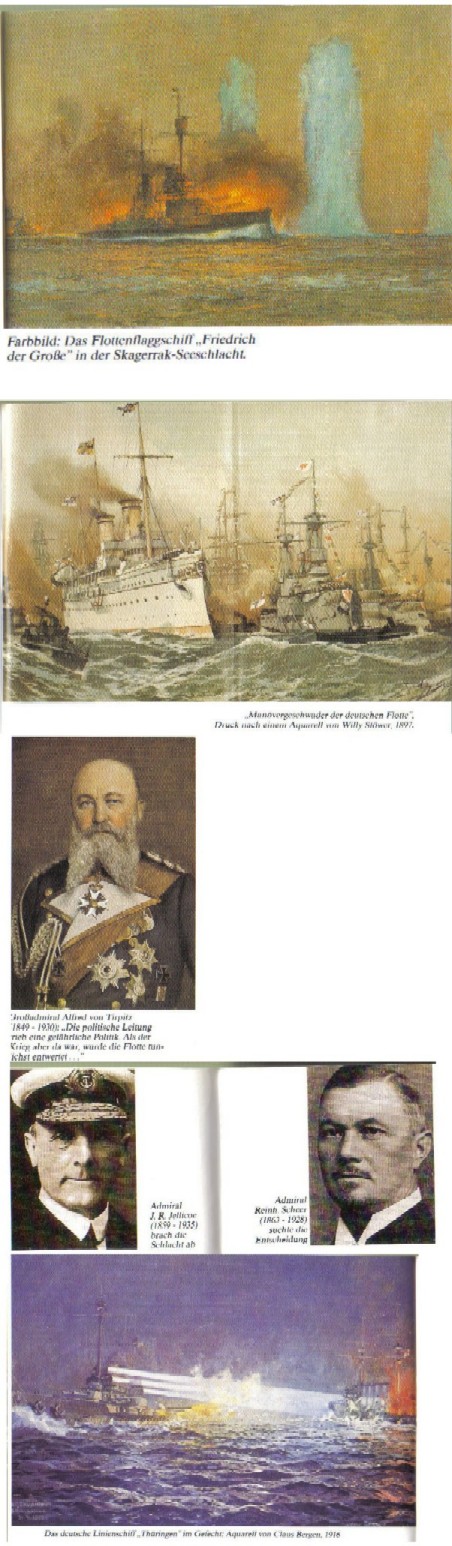 Aus diesem nassen Käfig konnte die deutsche Flotte nur im Zuge einer großen Schlacht ausbrechen. Das wäre 1914 gegangen, es wäre auch noch 1915 möglich gewesen, denn damals litt die britische Flotte unter derart hohen Ausfallquoten, daß sie über lange Monate mit der deutschen Flotte zahlenmäßig fast gleich stark war. Doch die Zeit arbeitete nicht für Deutschland. Am Ende des Jahres konnten die Briten sich wieder auf ihre numerische Überlegenheit verlassen, und deshalb sah die britische Admiralität dem Tag, an dem die deutsche Marine sich zu einer großen Aktion entschließen würde, mit Ruhe entgegen.
Aus diesem nassen Käfig konnte die deutsche Flotte nur im Zuge einer großen Schlacht ausbrechen. Das wäre 1914 gegangen, es wäre auch noch 1915 möglich gewesen, denn damals litt die britische Flotte unter derart hohen Ausfallquoten, daß sie über lange Monate mit der deutschen Flotte zahlenmäßig fast gleich stark war. Doch die Zeit arbeitete nicht für Deutschland. Am Ende des Jahres konnten die Briten sich wieder auf ihre numerische Überlegenheit verlassen, und deshalb sah die britische Admiralität dem Tag, an dem die deutsche Marine sich zu einer großen Aktion entschließen würde, mit Ruhe entgegen.

